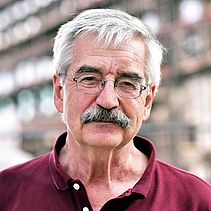Im Zuge der Globalisierung ist die Welt näher zusammengerückt, aber zu einem „globalen Dorf“, wie es manchmal hieß, wurde sie nicht. Zwar konnten vereinzelt Erfolge in der Bekämpfung der extremen Armut erzielt werden, doch hat sich die alte Kluft zwischen Arm und Reich eher noch verfestigt. Noch immer macht es einen Unterschied, ob wir in einer der reichen und mächtigen Regionen des „globalen Nordens“ zur Welt kommen oder im „globalen Süden“, den Zonen der Perspektivlosigkeit und des Elends, die sich längst auch am Rande europäischer und nordamerikanischer Großstädte ausgebreitet haben.
Mehr als 820 Millionen Menschen hungern in diesen Tagen, obwohl die in der Welt bestehenden landwirtschaftlichen Kapazitäten ausreichen würden, um nahezu das Doppelte der Weltbevölkerung satt zu machen. Vier Milliarden Menschen fehlen ausreichende sanitäre Einrichtungen. Zwei Milliarden haben keinen Zugang zu essenziellen Medikamenten, und während hierzulande an kostspieligen individualisierten Therapieverfahren geforscht wird, sterben alljährlich noch immer 25 Millionen Menschen an Krankheiten, die eigentlich gut behandelbar wären. Soziale Ungleichheit, so resümierte es die Weltgesundheitsorganisation (WHO), töte im großen Maßstab.
Die Ungleichheit spiegelt sich auch im Zugang zur Versorgung im Krankheitsfall. Von einem geregelten Beistand, wie er hierzulande noch immer existiert, können große Teile der Weltbevölkerung nur träumen. Die massiven Sparprogramme, die vielen Ländern bei ihrer Integration in den Weltmarkt aufgezwungen wurden, haben nicht zuletzt die dortigen Sozialsysteme in Mitleidenschaft gezogen. Als 2014 in Westafrika die Ebola-Epidemie ausbrach, erwiesen sich die wenigen noch verbliebenen staatlichen Gesundheitsstationen eher als Orte der Ansteckung als der Hilfe. Sie entbehrten selbst der einfachsten Ausstattung und waren meist hoffnungslos personell unterbesetzt.
Wo es keine oder nur schwach ausgebildete öffentliche Gesundheitsdienste gibt, sind die Leute auf private medizinische Dienstleistungen angewiesen. Nicht selten müssen sie ihr letztes Hab und Gut verkaufen, um aus eigener Tasche für Arztkosten aufkommen zu können. Solche „out of pocket“-Zahlungen, wie es bei der WHO heißt, schließen ausgerechnet diejenigen von einer angemessenen Versorgung aus, die sie aufgrund ihrer Lage am meisten bräuchten: die Armen und Mittellosen.
Die Verhältnisse seien alternativlos, behaupten Politikerinnen und Politiker mitunter, um die in der Welt herrschende Ungleichheit zu rechtfertigen. Einschnitte in die öffentliche Daseinsvorsorge seien nötig, um die Wirtschaft im Schwung zu halten. Und letztlich sei doch jeder für sich selbst verantwortlich. Für Wohlhabende mag solche Eigenverantwortung kein Problem sein, für Arme führt sie immer wieder in die Katastrophe. Nach Schätzungen der WHO werden alljährlich 100 Millionen Familien durch privat zu erbringende „katastrophale Gesundheitsausgaben“ in die Armut getrieben.
Ausbruch aus dem Teufelskreis
Armut macht krank und Krankheit arm, heißt es im Volksmund. Ein Ausbruch aus diesem Teufelskreis aber ist möglich, wenn wenigstens zwei Voraussetzungen gegeben sind. Einerseits muss der Zugang zu Versorgungsleistungen von der individuellen Kaufkraft entkoppelt und durch solidarisch finanzierte gesellschaftliche Institutionen sichergestellt werden. Andererseits gilt es Gesundheit als Gemeingut zu begreifen, das nur außerhalb der Sphäre kapitalistischen Wirtschaftens verwirklicht werden kann.
Die Sorge um Lebensmittelsicherheit, die Erforschung essenzieller Arzneimittel, die Sicherstellung nachhaltiger Müllbeseitigung oder eine flächendeckende Gesundheitsversorgung: All das sind öffentliche Aufgaben, die sich nur bedingt mit profitorientierten und auf Wachstum ausgerichteten Geschäftsinteressen vertragen. Gemeingut-Ökonomien funktionieren nur dann, wenn die vorhandenen Mittel weder unter- noch übergenutzt werden. Was das bedeutet, ist in demokratischen Prozessen gesellschaftlich zu entscheiden und kann nicht den Opportunitätsüberlegungen privater Kapitalanleger überlassen bleiben.
Die gegenwärtige Auslieferung des Gemeingutes Gesundheit an den Markt mag neue renditeträchtige Geschäftsmodelle eröffnen, führt aber aus gesundheitspolitischer Sicht in die Irre. Nicht mehr Markt ist nötig, um das Gesundheitswesen zu verbessern, sondern die Wiedergewinnung von Formen institutionalisierter Solidarität.
Soziales Eigentum
Gesundheit für alle ist möglich, wenn diejenigen, die besser gestellt sind, auch für die Gesundheitsbedürfnisse der Ärmeren einstehen. Solange es innerhalb der Gesellschaften und zwischen ihnen ein Armutsgefälle gibt, ist solidarisches Umverteilen unumgänglich.
Umverteilung ist kein Schreckgespenst. Die Idee eines solidarischen Ausgleichs prägt seit alters her die Kulturen indigener Gesellschaften, gehört zum Kern der katholischen Soziallehre und ist Grundlage auch des modernen Gesellschaftsvertrags, der mit der europäischen Aufklärung aufgekommen ist. In der Praxis kommt Umverteilen in genossenschaftlich betriebenen Dorfapotheken ebenso zum Ausdruck wie in steuerfinanzierten kommunalen Wasserwerken, gesetzlich geregelten Krankenversicherungen und vielen anderen gesellschaftlichen Institutionen. Zusammen bilden solche Institutionen jene soziale Infrastruktur, ohne die menschliches Zusammenleben auf Dauer nicht möglich ist.
Es verwundert deshalb nicht, dass Umverteilen nach wie vor auf breite Zustimmung trifft. Drei Viertel der deutschen Bevölkerung sind der Auffassung, dass Personen mit hohem Einkommen und viel Vermögen mehr Steuern zahlen sollten, damit mehr Geld für öffentliche Aufgaben zur Verfügung stehe. Unter denen, die eine stärkere Besteuerung befürworten, würden 77 Prozent die Vermögensteuer und 67 Prozent die Einkommensteuer erhöhen, so eine 2017 durchgeführte Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die Aufkündigung solidarisch verfasster Gesellschaftlichkeit, die neoliberale Politiker zum Programm erhoben haben, ist nicht die Sache der Leute.
Funktionierende Daseinsvorsorge gründet sich auf ihre solidarische Finanzierung. Dabei ist es nicht eigentlich von Bedeutung, ob die Mittel über Steuern oder über Pflichtbeiträge zu gesetzlich geregelten Sozialversicherungen zustande kommen. Entscheidend ist, dass alle, gestaffelt nach dem individuellen Vermögen, zur Finanzierung beitragen und selbst jene, die zu arm sind, um auch nur einen Cent beizusteuern, dennoch die gleichen Versorgungsleistungen bekommen wie alle anderen. Der Kern von Umverteilung ist die Umwandlung von privatem Eigentum in ein „soziales Eigentum“, auf das im Bedarfsfall auch diejenigen zurückgreifen können, die über kein privates Vermögen verfügen.
Solidarität meint folglich nicht allein eine emotionale Verbundenheit, sondern die verpflichtende Sorge um das Wohl aller. Um die sicherzustellen, bedarf es entsprechender gesellschaftlicher Institutionen, deren Ziel nicht die Verstaatlichung der Gesellschaft ist, wie es mitunter behauptet wird, sondern die Re-Sozialisierung von öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft.
Kosmopolitische Solidarität
Mit Blick auf den erreichten Globalisierungsgrad ist Gesundheit heute nicht mehr nur im nationalen Rahmen zu verwirklichen. Der Klimawandel, die globalisierten Produktionsverhältnisse, der globale Handel und die weltweite Mobilität von Menschen haben erhebliche Konsequenzen auch für die Gesundheit. Der ökonomische Wettbewerb, der zwischen den Ländern und Regionen herrscht, hat nicht nur zur Aushöhlung von Sozialpolitik geführt, sondern die soziale Verunsicherung von Menschen mitsamt ihren psychischen Folgeproblemen dramatisch anwachsen lassen. Ohne eine Re-Regulierung der globalen Ökonomie und ohne die Internationalisierung sozialer Sicherung im Rahmen länderübergreifender Umverteilungsmechanismen wird Daseinsvorsorge auch im nationalen Rahmen immer weniger zu verteidigen beziehungsweise weiterzuentwickeln sein. Die Hoffnung, inmitten einer von Krisen geschüttelten Welt eine sozialpolitische Idylle aufbauen zu können, ist durch nichts gedeckt.
Deshalb ist es höchste Zeit, für eine Ausweitung des Solidarprinzips ins Globale zu sorgen. Ideen, wie das gelingen kann, gibt es durchaus. Denkbar ist zum Beispiel ein universelles Grundeinkommen, aber auch die Einrichtung eines „Internationalen Fonds für Gesundheit“, der reichere Länder vertraglich dazu verpflichtet, auch zu den Sozialbudgets der ärmeren Länder beizutragen.
Eine solche „globale Bürgerversicherung“ könnte auf internationaler Ebene das befördern, was der deutsche Länderfinanzausgleich auf nationaler Ebene beabsichtigt: eine Balancierung der fiskalischen Möglichkeiten der Länder. Und ein solcher internationaler Finanzausgleich ist bitter nötig. 40 Länder, so schätzt die WHO, könnten heute selbst dann nicht den Gesundheitsbedürfnissen ihrer Bevölkerungen entsprechen, wenn sie alle zur Verfügung stehenden Ressourcen aktivierten. Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, haben in der Vergangenheit Länder wie Brasilien oder Südafrika immer wieder auf einen verstärkten Raubbau an der Natur gesetzt. Und so ist es auch der Kampf gegen die ökologische Verwüstung der Welt, der nach solchen länderübergreifenden sozialen Transferleistungen verlangt.
Eine „globale Bürgerversicherung“ bräuchte übrigens keine aufgeblähte Verwaltungsstruktur. Sie könnte sich auf das Bündeln und den Transfer von Mitteln beschränken, so wie es der Europäische Sozialfonds schon seit Jahren tut. Von dessen Bemühen, zwischen den Regionen Europas für einen Ausgleich im Bereich der Bildung, der Unterstützung von Arbeitslosen und bei anderen sozialen Diensten zu sorgen, profitierten in den zurückliegenden Jahren weit über 100 Millionen Menschen – ohne dass davon immer die Rede war.
Warum sollte das, was auf nationaler und regionaler Ebene bereits gelingt, nicht auch international verwirklicht werden können? Eine globale Bürgerversicherung jedenfalls scheitert weder an fehlenden organisatorischen Voraussetzungen noch am Mangel an Geld. Schon mit den heute weltweit für Gesundheit aufgewendeten Mitteln ließe sich für alle Menschen eine angemessene Gesundheitsversorgung verwirklichen.
Es ist gut, dass die Idee globaler Ausgleichsfinanzierungen inzwischen auch in den Vereinten Nationalen angekommen ist. Eine ganze Reihe von Fragen gilt es zu klären, gewichtige sogar. Die Frage etwa, wie der längst auch im Gesundheitswesen herrschenden Korruption begegnet und eine sachgerechte Nutzung von Ressourcen sichergestellt werden kann. Oder Fragen der demokratischen Kontrolle, um Entscheidungen etwa über gesundheitliche Prioritäten tatsächlich an den Bedürfnissen und Rechtsansprüchen der Menschen ausrichten zu können.
Alle diese Fragen werden sich lösen lassen, sofern es gelingt, ein kosmopolitisches Verständnis von Solidarität zu entfalten, eines, das in den globalisierten Verhältnissen auch die Chance für ein Weltweit-Werden der Welt sieht. Für weltgesellschaftliche Verhältnisse, in denen, so Immanuel Kant vor über 200 Jahren, „die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird“.
Der utopische Raum
Am Dienstag, 19. November, hält Thomas Gebauer seinen Vortrag „Globale Bürgerversicherung – eine Utopie des Helfens“ im Osthafenforum im medico-Haus, Lindleystraße 15 (gegenüber Haus Nummer 11). Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach dem Vortrag wird FR-Autor Stephan Hebel mit Thomas Gebauer und dem Publikum über das Konzept der globalen Bürgerversicherung sprechen.
„Der utopische Raum“ heißt die von der medico-Stiftung initiierte Reihe, die mit diesem Abend fortgesetzt wird. Nach dem Auftakt Ende September unter dem Titel „Es geht auch anders!“ (die FR berichtete) soll bis zur Abschlussveranstaltung am 12. Mai 2020 (Gast: Harald Welzer) der „utopische Raum“ in monatlicher Folge anhand einzelner Beispiele vermessen werden.
Die Frankfurter Rundschau tritt bei der Veranstaltungsreihe als Kooperationspartnerin der Stiftung medico international auf.