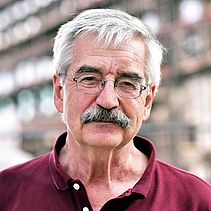Von Thomas Gebauer
Mit utopischem Überschwang beschloss die WHO 1978 in Alma Ata die Strategie der primären Gesundheitsversorgung, die „Gesundheit für alle“ versprach. Nach großen Erfolgen droht ihr heute, 40 Jahre später, das Aus. Auf paradoxe Weise hat daran auch die neue UNO-Politik der SDG-Agenda Anteil.
Die Euphorie war groß als im September 2015 die Vereinten Nationen die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) verabschiedeten. Endlich eine globale Agenda, die alle Länder zu Aktivitäten verpflichtet, die aus der Krise herausführen sollen. Inzwischen hat sich die Begeisterung gelegt. Immer deutlicher werden die Fallstricke, die in den Ausführungsbestimmungen der Agenda, dem Kleingedruckten, angelegt sind.
Nicht über eine gerechte Verteilung der weltweit vorhandenen Ressourcen sollen die Ziele verwirklicht werden, sondern allein durch Wirtschaftswachstum. Wobei jedes Land für die benötigten Mittel selber aufkommen muss. Unter Respektierung aller internationalen Verpflichtungen, versteht sich, so auch der vielen Freihandelsabkommen, die den sozialpolitischen Handlungsspielraum gerade der ärmeren Länder drastisch einschränken und sie einer zerstörerischen Extraktionswirtschaft ausliefern.
Um die breitgefächerte SDG-Agenda umzusetzen aber bedarf es großer Anstrengungen und sehr viel Geld. Vorsichtige Schätzungen belaufen sich auf drei bis vier Billionen Dollar pro Jahr. Mit den knapp 150 Milliarden Dollar, die gegenwärtig von den Industrieländern für die Entwicklungszusammenarbeit aufgewendet werden, kommt man nicht weit. Auch die 64 Milliarden Dollar, die von privaten Philanthropen beigesteuert werden, bleiben nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie also soll die Umsetzung der SDGs finanziert werden?
Alexander De Croo, Unternehmer und belgischer Entwicklungshilfeminister behauptet, die Lösung zu wissen. Auf der Brüsseler Hilfsgütermesse AidEx stellte er im Herbst 2017 sein Konzept vor. Die wundersame Umwandlung von Milliarden in Billionen gelinge, wenn die unzureichenden öffentlichen Mittel genutzt würden, um Anreize für private Kapitalgeber zu schaffen. Nachhaltige Hilfe, so De Croo, verlange nicht nach mehr „Geben“, sondern nach mehr „Investieren“.
Zukunftsmusik? – Seit einigen Jahren schon beschäftigen sich Entwicklungspolitiker mit der Frage innovativer Finanzierungskonzepte, die privates Kapital für soziale und ökologische Zwecke nutzbar machen sollen. An Geld mangelt es ja nicht. Es ist sogar im Überfluss vorhanden. Aufgrund der neoliberalen Finanz- und Steuerpolitik ist es nur nicht dort, wo es gebraucht wird. Den fehlenden öffentlichen Mitteln, um für alle beispielsweise das Recht auf Gesundheit zu realisieren, stehen riesige private Vermögen gegenüber, deren Verwalter heute händeringend nach profitablen Anlageoptionen suchen. Die Lücke, die der neoliberale Kahlschlag in der Sozialpolitik hinterlassen hat, machen sich nun Kapitalanleger zunutze.
Impact Investing heißt für sie das neue Zauberwort. Es steht für Investitionen, die neben einer finanziellen Rendite auch soziale und ökologische Wirkungen erzielen wollen. Von einer neuen Partnerschaft zwischen Geschäftswelt und Sozialwesen ist bereits die Rede. Wie groß die Gefahr ist, dass sich dabei soziales Handeln endgültig in eine Handelsware verwandelt, zeigt sich bereits in der Kontaminierung der Sprache mit Begriffen aus der Finanzbranche. Zu den propagierten neuen Finanzierungsinstrumenten zählen Direktinvestitionen z.B. im Health Care Business, Social Impact Bonds oder hybride Fonds, in denen die Beimischung von öffentlichen Zuschüssen und Spenden für eine Hebelung der Eigenkapitalrendite sorgt. Das Schöne an Sozial-Anleihen sei, so der belgische Entwicklungshilfeminister, dass Unternehmen an den Risiken des sozialen Handelns beteiligt werden.
Kontaminierung der Sprache
Und genau darin liegt das Problem. Börsennotierte Kapitalgesellschaften, wie z.B. die Rückversicherer, die gerade den Aufbau von Rehabilitationszentren in Afrika finanzieren, wollen nicht einfach nur „Geben“, sondern am Ende Geld sehen. Sie verlangen aus öffentlichen Mitteln einen „return on investment“, den sie aber nur bekommen, wenn die gesetzten Ziele erreicht wurden. Je komplexer diese sind, desto größer das Risiko des Scheiterns. Im Falle der afrikanischen Reha-Zentren haben die Kapitalgeber darauf gedrängt, den Erfolg an der Zahl der angefertigten Prothesen zu messen. So wichtig Prothesen sind, reichen sie doch nicht aus, um Menschen mit Behinderungen die volle gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das komplexe Bemühen um soziale Inklusion ist voller Unwägbarkeiten. Es lässt sich kaum kalkulieren und nur schwer messen: für Impact Investing uninteressant.
Zeitnah und zählbar
Und so bleibt der Einzug unternehmerischer Risikoabwägung in die Planung von Hilfe nicht ohne Rückwirkung auf die Hilfe selbst. Für holistische, ganzheitliche Sichtweisen gibt es dort, wo betriebswirtschaftliche Kennziffern dominieren, keinen Platz. Die Kapitalisierung von Hilfe lässt das soziale Handeln verarmen. Große Ziele wie Frieden und interkulturelle Verständigung, aber auch das Bemühen um demokratische Partizipation und soziale Gerechtigkeit, die beiden Säulen der 1978 in Alma Ata beschlossenen Primary Health Care Strategie der WHO, müssen heute weniger ambitionierten Zielen weichen, die sich zeitnah und einfach erreichen lassen.
Auch der neue WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus würde die Alma-Ata-Strategie gerne auf Ziele reduzieren, die mit den Interessen der Geschäftswelt kompatibel sind. Der finanzielle Druck, der auf Institutionen wie der WHO lastet, ist groß. Viele können ihre Aufgaben nur erfüllen, wenn sie sich für privates Kapital öffnen. Pharmakonzerne, die noch vor wenigen Jahren wegen ihrer skandalösen Patentpolitik am Pranger standen, gelten heute als diskrete Partner in der Versorgung von Menschen mit Hilfsgütern.
Auch Hilfsorganisationen befinden sich in einem großen Dilemma. Es könnte, so es denn als solches erkannt würde, auch dazu motivieren, auf eine radikale Korrektur der neoliberalen Steuer- und Finanzpolitik zu drängen, die den Teufelskreis erst in Gang gesetzt hat. Dass es dazu nicht kommt, dafür sorgen die Ideen einer neuen Schule, die sich „Effektiver Altruismus“ nennt und die den New Deal in der Finanzierung von Hilfe mit sozialphilosophischen Floskeln ideologisch verbrämt. Weil die herrschenden Verhältnisse alternativlos seien, so der Vordenker der effektiven Altruisten Peter Singer, mache es auch keinen Sinn, sich noch länger mit den strukturellen Ursachen von Not und Unmündigkeit aufzuhalten. Weil zudem die Mittel knapp seien, müsse sich Hilfe, um effektiv zu sein, an betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Kalkulationen ausrichten.
Es ist kein Zufall, dass es zwei New Yorker Hedge-Fonds-Analysten waren, die 2007 die Organisation „GiveWell“ gegründet haben. Mit einem „Charity Evaluator“ ermitteln sie seitdem alljährlich die effektivste Wohltätigkeitsorganisation. Wichtigste Berechnungsgröße ist ein mathematisch erfasster Quotient aus den Kosten z.B. für die Behandlung einer Krankheit und dem Zugewinn an „qualitätskorrigierten Lebensjahren“ (QALY). Laut „GiveWell“ ist die „Against Malaria Foundation“ die effektivste Hilfsorganisation. Die wendet für die Rettung eines Lebens ca. 2.300 Dollar auf. Die logische Konsequenz: teurere Hilfebemühungen sind ineffizient, das aufwendige Eintreten für gesundheitsfördernde Lebensumstände, die Krankheiten vorbeugen, schon gar. Nicht die Bekämpfung krankmachender Armut erscheint dann als Lösung, sondern das Verteilen von Moskitonetzen, Impfungen, die Gabe von Vitamintabletten, etc.
Wirksam ohne zu helfen
Solche technischen Lösungen lassen sich höchst einfach mit kommerziellen Interessen in Einklang bringen. Sie reduzieren soziales Handeln auf unternehmerische Kenntnisse und das Bereitstellen von Waren. Im Gegensatz zu einem langwierigen und mit vielen Rückschlägen versehenen Kampf der sozialen Ungleichheit, laut WHO der Killer Nummer eins, suggerieren sie höchste Wirksamkeit, ohne wirklich nachhaltige Abhilfe zu schaffen.
Und nebenbei lässt sich so auch der eigene Wohlstand rechtfertigen. Wer als Investmentbanker oder Börsenspekulant viel verdient, kann umso besser Gutes tun. „Earning to give“ nennen effektive Altruisten dieses Prinzip. Eine präzise kalkulierte Verteidigung von Privilegien, die sie anderen verweigern.
Mit der „Erklärung von Alma Ata“ stellte die WHO Gesundheit in den Kontext eines politischen Drängens auf soziale Gerechtigkeit und demokratische Partizipation. Den visionären Gehalt der Grundsätze des Primary Health Care umzusetzen, ist heute nötiger denn je. Gesundheit lässt sich nicht durch eine Optimierung des Falschen verwirklichen, sondern nur über eine tiefgreifende Veränderung der globalen Verhältnisse.
„Hilfe? Hilfe! – Wege aus der globalen Krise“
Das Buch von Thomas Gebauer und Ilija Trojanow widmet sich in Essays und Reportagen ausführlich der Krise der Hilfe.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 2/2018. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. <link verbinden abonnieren>Jetzt abonnieren!