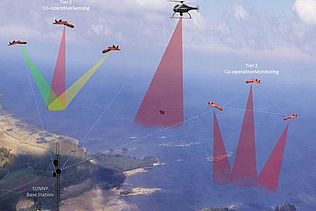„Wo wollen Sie hin?“, fragt der polnische Grenzpolizist. „Hier fängt die Sperrzone an. Kriegszustand.“ Nur zwei Dörfer entfernt stecken an diesem Herbstmorgen noch immer 32 afghanische Geflüchtete auf Pappdeckeln und Plastiktüten auf dem bewaldeten Grenzstreifen zwischen Polen und Belarus im Schlamm fest. „Presse“, sage ich und zeige meinen Ausweis durch die Autoscheibe. Dabei kenne ich schon die Antwort. Seit Anfang September darf niemand die Sperrzone betreten – ausgenommen polnische Soldaten und die Einwohner der 183 Grenzorte. Journalistinnen und Journalisten müssen draußen bleiben, genauso wie Ärzte und Anwältinnen. Dabei leben seit Monaten Hunderte Geflüchtete ohne rechtliche Beratung, medizinische Versorgung, ausreichend Wasser oder Essen auf dem über 400 Kilometer langen, bewaldeten Grenzstreifen. Die meisten eingekesselt zwischen belarussischen und polnischen Grenzschützern. In den vergangenen Wochen wurden acht Menschen, aufgrund von Erfrierungen und Unterversorgung, tot im Wald aufgefunden. Und die Temperaturen im Grenzwald fallen immer weiter unter null.
Seit diesem Sommer holt der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko gezielt Geflüchtete ins Land, um sie in Richtung Litauen oder Polen weiterzuschicken und damit Druck auf die EU auszuüben. „Wir Migranten sind die Fenster, durch die die Einheimischen die Welt sehen können“, schrieb der Medientheoretiker Vilém Flusser in seinem Buch „Von der Freiheit des Migranten“, das bei dieser Recherche neben mir auf dem Autositz liegt. Er beschreibt darin Migration als einen kreativen Prozess: „Die Heimat des Heimatlosen ist der Andere.“ Doch was passiert, wenn keine Begegnung mit dem „Anderen“ mehr möglich ist? Wenn flüchtende Menschen als politisches Druckmittel eingesetzt und an den europäischen Grenzen immer gewalttätiger zurückgedrängt werden und die Ränder der Peripherie, die Fluchtlager und Haftanstalten, in denen Geflüchtete oft jahrelang ausharren, immer unzugänglicher werden?
Das Zeichen: Abschottung
„Wir werden nicht zulassen, dass Polen zu einer weiteren Route für den Massenschmuggel von illegalen Migranten in die Europäische Union wird“, sagt der polnische Innenminister Mariusz Kaminski Anfang September, als immer mehr Menschen den Bialowieza-Urwald erreichen und dort wochenlang in lebensgefährlichen Zuständen feststecken. „Würden wir den Menschen Asyl gewähren und sie nicht im Wald erfrieren lassen, wäre das ein stärkeres Zeichen für Polen“, sagt hingegen die EU-Parlamentarierin Janina Ochojska, „es würde Lukaschenko den Wind aus den Segeln nehmen“. Doch die polnische Regierung reagiert, wie auch Griechenland oder Kroatien, mit dem Bau eines 100 Kilometer langen Grenzzauns und der systematischen Zurückweisung der geflüchteten Menschen auf belarussisches Gebiet. Und sie schickt Tausende Soldaten und Soldatinnen ins Grenzgebiet.
Ich starte meinen Motor, um an der Straßensperre vor dem Dorf Usnarz Gorny zu wenden. Da dreht sich der Polizist noch einmal um und klopft auf meine Motorhaube: „Kofferraum öffnen“, sagt er. Kurze Zeit später steht er vor einer Müslipackung, Bergstiefeln und drei Flaschen Wasser. Die darf ich transportieren. Würde ich eine geflüchtete Person mitnehmen, hätte ich mich strafbar gemacht. In diesen Tagen wird mir klar, wie groß die Verunsicherung der Bevölkerung ist, die immer wieder auf entkräftete und schwer kranke Menschen trifft, die es doch aus der Sperrzone geschafft haben. Ab wann wird Nothilfe strafbar? Am nächsten Tag stehe ich auf dem Hof eines Viehbauern. „Meine Schwester hat ein paar Geflüchtete am Waldrand gefunden“, sagt er. Sie habe ihnen frische Kleider und Wasser gegeben. Dabei rief sie ihn immer wieder an. Er versicherte, dass sie nichts Illegales tat. Nur Geld dürfe man nicht annehmen oder sie im Auto zum Krankenhaus transportieren. „Es ist eine verflixte Sache.“
Rechtliche Parallelwelt
Sechs Jahre nach dem Höhepunkt der sogenannten Fluchtkrise setzten die Europäischen Mitgliedstaaten vor allem auf eines: Abschreckung. Nicht nur in Polen oder in Griechenland, auch am Grenzübergang zu Kroatien oder an der italienisch-libyschen Seegrenze. Allein im letzten Jahr soll es laut dem Danish Refugee Council (DRC) an der bosnisch-kroatischen Grenze zu über 16.000 illegalen Pushbacks von kroatischen Grenzschützern gekommen sein, darunter 800 Kinder, die keine Chance bekommen, einen Asylantrag zu stellen. 60 Prozent dieser dem Völkerrecht und dem EU-Recht widersprechenden Pushbacks verlaufen gewalttätig: Maskierte Männer und Grenzbeamte treten auf Geflüchtete ein, setzen Schlagstöcke und Elektroschocks ein.
Auch auf den griechischen Inseln häufen sich die Menschenrechtsverletzungen. Immer mehr Journalistinnen, Zivilisten und Touristinnen berichten von maskierten Männern, die auf Motorrädern den Norden der Insel Lesbos patrouillieren, nachdem ein Boot durch die Abgrenzung der griechischen Küstenwache gebrochen ist. Nach ausführlichen Recherchen konnte nachgewiesen werden, dass diese Pushbacks systematischer werden. Schon im Frühling registrierte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR „mehrere Hundert“ mutmaßliche Pushbacks.
Für diejenigen, die es noch durch die Grenzkontrollen schaffen, bleibt in den Hochsicherheitslagern auf den griechischen Inseln, in den Haftanstalten in Polen oder in den isolierten Fluchtheimen in Kroatien meist nur das Warten ohne Ziel. In Griechenland allein sitzen im Moment 2.400 Menschen in Abschiebeanstalten fest, ohne zu wissen, was mit ihnen geschehen soll. Auch hier hat die Presse keinen Zugang. Aus einer humanitären Krise, die Tausende Menschen 2015 aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in Richtung Europa fliehen ließ, wurde eine europäische Wertekrise. An den Grenzen ist eine rechtliche Parallelwelt entstanden, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit existiert und durch die gezielte Verunsicherung der lokalen Bevölkerung und Kriminalisierung humanitärer Hilfe möglich gemacht wird.
Letzte Woche erzählte mir eine Freundin beiläufig in einer Bar in der Hafenstadt von Lesbos, dass eine Freundin einige Tage zuvor einen durchnässten Mann mit seinem Rucksack in ihrem Vorgarten gefunden habe. Sie habe sie erschreckt angerufen, weil sie nicht wusste, ob sie ihm helfen durfte oder deshalb des Schmuggels angeklagt würde. Schlussendlich habe sie ihm nur den Weg zum Fluchtlager gezeigt und eine Flasche Wasser mitgegeben. Sie macht eine Pause, dann sagt sie: „Eigentlich habe ich mich in diesem Moment gefragt, ob ich mich schuldig mache, wenn ich einen Menschen menschlich behandele.“ Das ist das Ergebnis einer europäischen Politik, die in ihren Anstrengungen, die Grenzen vor Flüchtenden zu verschließen, die Genfer Flüchtlingskonvention immer weiter aushebelt, und deren Vorstellung von Recht und Unrecht immer kafkaeskere Blüten treibt.
Kriminalisierung der Hilfe und der Flüchtenden
Schon vor drei Jahren wurden der deutsch-irische Seenotretter Seán Binder und die syrische Schwimmerin Sarah Mardini des Menschenschmuggels, der Spionage und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt, nachdem sie über ein Jahr lang Erstversorgung für Geflüchtete an der griechischen Küste geleistet hatten. Trotz dünner Beweislage mussten Binder und Mardini drei Monate in Haft verbringen, bevor sie kurz vor Weihnachten, im Dezember 2018, mit einer Kaution freikamen. Demnächst soll ihr Prozess in Mytilini stattfinden. Er könnte theoretisch mit einem Urteil über 25 Jahre Haft enden. Doch nicht nur die Seenotrettung wird zunehmend kriminalisiert, auch die Flüchtenden selbst werden in immer drastischeren Prozessen in Griechenland zu langen Haftstrafen verurteilt. Auf Lesbos wurde ein Somalier in diesem Sommer zu 142 Jahren Haft verurteilt, weil er das eigene Flüchtlingsboot auf die Insel gesteuert hatte. Im Februar wurde eine 26-jährige Afghanin, noch im Krankenhausbett von Mytilini liegend, von der Staatsanwaltschaft der Brandstiftung angeklagt, nachdem sie sich im Februar aus Verzweiflung in ihrem Zelt angezündet hatte.
Die eigentliche Erfahrung der Flucht und Vertreibung zählt hier nicht mehr. Dabei sind es die Menschen, die von all diesen politischen Entscheidungen betroffen sind und jeden Tag Wege finden müssen, in diesem System zu überleben. Sie treiben tagelang auf rostigen Frachtern in der Ägäis, ohne evakuiert zu werden; sie bleiben in Abrisshäusern zwischen Kroatien und Bosnien zurück, wo sie Glühbirnen aus der Fassung drehen, damit die Polizei sie nicht sieht und sie versteckt mit Journalisten und Fotografinnen sprechen können; sie backen Brot in den Böden des verbrannten Fluchtlagers Moria, da es für sie Selbstbestimmung bedeutet, das eigene Essen zu kochen; sie unterrichten ihre Kinder in durchnässten Schlafsäcken zwischen Grenzschützern oder sie werden heimlich in den Kellern von polnischen Viehbäuerinnen versorgt. Sie zahlen einen hohen Preis, weil sie in Europa Hoffnung suchten. Die europäische Erzählung, die doch für sich Demokratie und Menschenrechte beansprucht, wird an den Außengrenzen neu geschrieben. Dafür müssen wir eben jenen zuhören, die an ihre ursprüngliche Version glaubten.

Franziska Grillmeier lebt als freie Journalistin auf der Insel Lesbos. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Erfahrung von Flucht und Vertreibung, Gesundheitsversorgung in Krisengebieten und die Europäische Migrationspolitik. Für ihre Recherchen ist sie von Deutschland bis in den Nahen Osten unterwegs.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 4/2021. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!