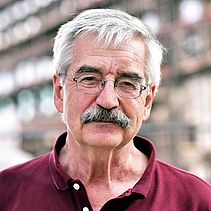„Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.“ Diese bemerkenswerte Diagnose schrieb Antonio Gramsci, der von den italienischen Faschisten verfolgte Politiker und Philosoph, noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges: sie geht heute um die Welt. Graswurzelbewegungen in Lateinamerika beziehen sich auf sie, kritische Wissenschaftler im Nahen Osten, Menschenrechtsaktivistinnen in Asien, die medico-Partner in Afrika. Und sie alle können die gesellschaftlichen Pathologien, mit denen sie sich herumzuschlagen haben, sehr genau benennen. Wahre Monster haben sich ihnen, die auf das Neue drängen, in den Weg gestellt und sorgen heute landauf, landab für Unheil.
Kriminelle Banden, wie die Maras in Mittelamerika, die das Scheitern nationalstaatlicher Institutionen nutzen und heute große Teile des Subkontinents terrorisieren; Privatarmeen, die in wachsenden rechtsfreien Räumen den rücksichtslosen Raubbau an Mensch und Natur absichern; religiöse Fundamentalisten, die mit Gewalt und überkommenen Dogmen alle sich öffnenden politischen Räume ersticken; rechtspopulistische Bewegungen und Parteien, die die heute gegebene Möglichkeit des „Weltweit-Werdens“ der Welt im Heil rassistisch aufgeladener Nationalismen zunichtemachen. So verschieden die Gestalt der heutigen Monster ist, verweisen sie doch auf eine gemeinsame Wurzel: auf die Krise der Demokratie, die sich im Zuge der Globalisierung dramatisch verschärft hat.
Denn globalisiert hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten nur die ökonomische Macht, nicht aber die demokratischen Verhältnisse. Auf prekäre Weise scheint Demokratie heute aus der Zeit gefallen zu sein. Statt auf drängende Fragen, wie den globalen Klimawandel oder die weltweite Migration, nach transnationalen Antworten zu suchen, bleibt sie im Nationalen verhaftet. Wenn der Blick über die Landesgrenzen hinausreicht, dann nur um den eigenen Standort zu sichern. Das aber heizt die Krise nur weiter an; wirkliche Auswege werden so dauerhaft verstellt. Was bleibt, ist die Radikalisierung des Bestehenden, der Rückfall in autoritäre Herrschaftsformen, die rechtsradikale Wende, mit der die Verantwortung für die anhaltende Misere ausgerechnet denen zugeschrieben werden kann, die am meisten unter den negativen Folgen der Globalisierung leiden.
Beispiel Honduras: Nicht die neoliberal erzwungene Schwächung der dortigen öffentlichen Institutionen gilt als die Bedrohung, nicht die Drogenkartelle und kriminellen Banden, die sich in der Folge als Staat im Staat entwickeln konnten, sondern die Menschen, die sich nicht länger der Willkür der Drogenkartelle und der kriminellen Banden ausliefern wollen. Zu Tausenden haben sie sich auf den langen Marsch durch Mexiko in die USA gemacht; ein Fanal, das dem Todeskult der Banden ein unübersehbares Bekenntnis zum Leben entgegensetzt. Die Antwort Donald Trumps: Mit den Flüchtenden drohe die Zersetzung der USA; Terroristen, Drogenhändler und Kriminelle seien im Anmarsch; Soldaten müssten aufmarschieren.
Auch der gerade gewählte Präsident Brasiliens, Bolsonaro, macht keinen Hehl aus der Missachtung moralischer und demokratischer Grundfeste. Auch er stößt effektvoll ins rechtspopulistische Horn. Was ihn mit anderen Rechtspopulisten eint, ist die Bereitschaft zur Vernichtung politisch Andersdenkender, die wahnhafte Erzwingung von Gefolgschaft, aber auch die Nähe zu einer eigentümlichen Form gewaltbereiter Männlichkeit. Die reicht von machohafter Selbstinszenierung über die Herabwürdigung von Frauen bis hin zur Verharmlosung von Diktatur und Vergewaltigung.
Nicht von ungefähr erinnern solche Haltungen an die Männerbünde, die im ausgehenden deutschen Kaiserreich als Reaktion auf die sich damals ereignenden gesellschaftlichen Umwälzungen entstanden. Erstmals drangen Frauen in die Öffentlichkeit; die Psychoanalyse begann das Tabu Sexualität zu erforschen; Kunst und Kultur beschritten ungewohnte neue Wege und mit der Entmystifizierung des soldatischen Handelns im Ersten Weltkrieg machten sich schließlich auch pazifistische Bestrebungen breit.
Die befreiende Zivilisierung der Gesellschaft aber führte auch zu Verunsicherungen; alte Hierarchien bröckelten, überkommene Geschlechterrollen wurden in Frage gestellt. Nicht wenige Männer suchten Zuflucht in revanchistisch gesinnten Männerbünden. Dort konnte ein Männlichkeitsbild wiedererstarken, das alles Friedfertige, Demokratische und Weibliche ablegte und schließlich mithalf, den erkämpften politischen und kulturellen Aufbruch wieder abzuwürgen. Die weitere Geschichte ist bekannt; sie führte direkt in den Faschismus.
Man wolle „weg vom linksrotgrün-verseuchten 68er-Deutschland“, tönt es heute in der AFD; man wolle für die „Entsiffung des Kulturbetriebes“ sorgen. Die Monstrosität dieses Programms ergibt sich bereits aus der Ableitung des Wortes „Siff“ von „Syphilis“. Schon im Kaiserreich wurde die Angst vor Syphilis genutzt, um vor der Dekadenz des zivilisatorischen Fortschritts zu warnen. Angeblich verbreiteten Zuwanderer die Syphilis, die Juden, die Frauen. Nur über die Bekämpfung der Zivilisation selbst gelinge die Bekämpfung der Syphilis, die – mit Blick auf Frankreich als Hort so revolutionärer Ideen, wie der universellen Menschenrechte – nicht zufällig auch „Franzosenkrankheit“ genannt wurde. Wer von 68 weg will, der will auch vom kulturellen Aufbruch weg, der mit 68 verbunden ist, von den damals in den USA erkämpften Bürgerrechten und Diskriminierungsverboten, den größer gewordenen Chancen von Frauen, der gesellschaftlichen Liberalität und moralischen Ächtung von Kriegen. Schauen wir genauer hin, ist die Demokratie nicht zu Ende, sondern nur blockiert. Ihrer Krise entgegenzutreten, erfordert die Schaffung eines neuen transnationalen Gefüges, in dem der demokratische Prozess einen zeitgemäßen Raum finden kann. Notwendig ist die Entfaltung einer politischen Vision, die sich nicht damit begnügt, nur ein paar soziale Stellschrauben im eigenen Land neu justiert zu haben. Um zu neuen transnationalen Übereinkünften und Institutionen zu kommen, ließe sich dort anknüpfen, wo der demokratische Prozess noch immer (bzw. wieder) vital ist.
In Deutschland beispielsweise an den Demonstrationen und Kundgebungen der „unteilbar!“-Bewegung, die im Oktober 2018 250.000 Menschen auf die Straßen Berlins brachte, ein bunt sich zusammenfügendes Gebilde von Initiativen, die sich für Weltoffenheit, die Bewahrung der Umwelt, für menschenwürdiges Wohnen, neue Beziehungen zwischen den Geschlechtern und vieles andere engagieren, eine Kraft, ohne die sich die Monster der Gegenwart nicht werden vertreiben lassen.
Im nordirakischen Kifri, aber auch in Mossul, der zweitgrößten Stadt des Irak, betreiben heute Jugendliche Cafés und Zentren, in denen sie dem von machtbesessener Zerstörungswut geschundenen Land mit Theater, Musik und Bücherfestivals die Chance für einen Neuanfang geben wollen. Alle wissen um die Bedeutung, dabei mit anderen jungen Erwachsenen in den Anrainerstaaten in Kontakt zu kommen. Sie darin zu überstützen, ist von größter Bedeutung. Der Geist des IS sei im Verbogenen noch immer wirksam, sagen sie. Es wird lange brauchen, die Gespenster des Terrors zu bekämpfen.
Mit einem „March for our lives“ gingen im Frühjahr 2018 Hunderttausende von US-amerikanischen Schülerinnen und Schülern auf die Straße, die – begleitet von Solidaritätsdemonstrationen in über 40 Ländern – wirksame Einschränkungen des Waffenbesitzes forderten, ein weiteres Fanal gegen den Todeskult, der auch die Geschäfte der Waffenindustrie in Gang hält.
Wenig später brach der Protest der Studierenden in Nicaragua los. Ihre Forderung nach größeren politischen Freiheiten richtet sich gegen ein Regime, das zwar einige soziale Errungenschaften vorzuweisen hat, sich aber mehr und mehr als Entwicklungsdiktatur erwiesen hat und den Protest inzwischen mit paramilitärischen Schlägertrupps niederzuknüppeln versucht, die Erinnerungen an überkommen geglaubte Todesschwadronen wach werden lassen.
Wie in vielen anderen Ländern der Welt ist in Nicaragua die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in eine Schieflage geraten. Das Bemühen um Sicherheit dient immer weniger einem gesellschaftlich garantierten Schutz der Menschenrechte, sondern verkommt zur Absicherung von Privilegien und partikularen Machtinteressen.
Deshalb gehört zu den zentralen Themen, die sich dem demokratischen Prozess heute stellen, die Frage, wie die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit unter Maßgabe globalisierter Weltverhältnisse (neu) gefunden werden kann. Auch dabei ließe sich anknüpfen an dem, was schon ist. An den Ideen für neue transnationale Institutionen, wie einer globalen Bürgerversicherung etwa, oder an dem Drängen von Hunderten von Graswurzelorganisationen, sozialen Bewegungen, Bauernverbänden und Gesundheitsinitiativen aus aller Welt auf ein internationales Abkommen, das Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Die Forderung nach einer solchen Übereinkunft wurde zuletzt immer lauter; umso peinlicher, dass die Bundesregierung bremst.
Die Demokratie heute zu verteidigen, heißt, sie im globalen Kontext neu zu denken. Nur so lässt sich den finsteren Zeiten begegnen, nur so die Geburt des Neuen, das Bekenntnis zum Leben, solidarisch feiern.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 4/2018. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!