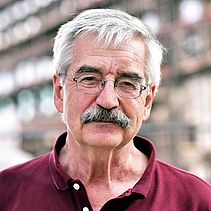Menschen in Not zur Seite zu stehen, ist ein moralischer Grundsatz; Hilfsbereitschaft Ausdruck funktionierender Gesellschaftlichkeit. Nicht mit Ausgrenzung, sondern mit Ausgleich reagieren demokratisch verfasste Gesellschaften auf Bedürftigkeit. Doch die Weise, wie wir einander zur Seite stehen, kann höchst verschieden sein. Es macht einen Unterschied, ob wir bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit von der Barmherzigkeit anderer abhängig sind oder ob wir uns auf soziale Sicherungssysteme verlassen können; ob wir um milde Gaben bitten müssen, die uns in Abhängigkeit halten, oder ob wir einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung genießen, der Grundlage einer selbstbestimmten Existenz und damit von Freiheit ist.
Von einem gesicherten Zugang zu öffentlicher Daseinsvorsorge kann eine bedrückend große Mehrheit der Weltbevölkerung heute nur träumen. Überall, vor allem aber im globalen Süden, sind Menschen davon abhängig, dass ihnen Wohlhabende etwas abgeben. Dabei gilt das barmherzige Engagement für Kranke und Arme oft als Inbegriff von Solidarität. Schauen wir genauer hin, zeigt sich mitunter ein anderes Motiv. Im Helfen kann auch Eigennütziges stecken. Vor allem, wenn die gute Tat zur Legitimation für eine Lebensweise verkommt, die man selbst auf Kosten anderer führt. Mit einer beiläufig beim Shopping geleisteten Spende wird das Gefälle, das zwischen Helfenden und Hilfebedürftigen besteht, nicht abgeschafft, sondern verstetigt. Zum bloßen Event verkommt Solidarität auf so mancher Wohltätigkeits-Gala, wenn diejenigen, für die gesammelt wird, nur den Anlass für einen unterhaltsamen Abend abgeben. Man spendet, um sich selbst zu gefallen; ob für hungernde Kinder im fernen Afrika oder für ein Krankenhaus nebenan ist zweitrangig.
Hilfe, die Not und Unmündigkeit nachhaltig überwinden will, muss auf gesellschaftliche Verhältnisse drängen, in denen niemand mehr von wohltätigen Aktionen abhängig ist. Solidarisch verfasste Gesellschaften aber entstehen nicht von selbst. Ohne ein Aufbegehren gegen Unfreiheit und Unrechtsverhältnisse, ohne gemeinschaftliches Handeln kommen sie nicht zustande. Solidarität steht somit nicht nur für das Versprechen einer anderen Welt, sondern bietet auch denen Halt und Schutz, die für sie streiten. Sie ist Ziel und Weg zugleich.
Aber nicht jedes gemeinschaftliche Drängen ist auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Eigennutz kann sich auch Mitstreiter suchen, um eigene Interessen wirkungsvoller durchsetzen zu können. Mit einer „Allianz der Willigen“ wurde im Irak Krieg geführt; in Solidarität streiten Automobilhersteller für lasche Umweltgesetze, sichern sich Großbauern üppige Agrarsubventionen und lehnen rechtspopulistische Bewegungen alles Fremde ab. Solche Formen von Solidarität, die das Eigene gegen das Andere verteidigen, zielen nicht auf eine für alle geltende Menschenwürde. Sie werden getragen von Konkurrenz und leben von der Ausgrenzung anderer.
Der Protest der Gelbwesten in Frankreich entzündete sich zwar am Plan der Regierung, fossile Brennstoffe höher zu besteuern, hat sich aber schnell zu einer politischen Bewegung ausgeweitet. Die Empörung schlug um in ein allgemeines Aufbegehren nicht nur gegen die flagrante Austeritätspolitik, sondern auch für eine andere, eine solidarische Gesellschaft. Die Politisierung der Gelbwesten brachte aber auch die Ambivalenz des Protests zutage. Während die Bereitschaft zu einer radikalen Kritik an den Verhältnissen wuchs, versuchten (Rechts-)Populisten den Protest zu einer Frage „nationaler Solidarität“ umzudeuten. Daraus lässt sich eines lernen: Die Gefahr, dass sich das Aufbegehren in andere ausgrenzende Parolen verliert, wird in dem Maße kleiner, wie es sich von partikularen Interessen löst.
Der Kampf um Befreiung bleibt solange offen, wie er gegen andere geführt wird und sich Solidarität nicht am Gemeinwohl ausrichtet. Ein bloßer Machtwechsel schafft noch keine andere Welt. Dazu muss sich sehr viel mehr ändern: unser Verhältnis zur Natur, die Produktionsweise, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die Aufteilung gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die Konsumgewohnheiten und nicht zuletzt unser Verständnis von Hilfe und Solidarität.
Für einen neuen Begriff von Hilfe und Solidarität bieten die Ideen der Französischen Revolution noch immer Orientierung. Zu deren Forderungen zählte neben Freiheit und Gleichheit auch die Fraternité, die Brüderlichkeit. Vielleicht weil wir uns mit der Übersetzung so schwer tun, wird die Bedeutung der Fraternité nicht immer gesehen. In ihrem Kern aber geht es um eine Solidarität, die weit über das bloße Gefühl innerer Verbundenheit und den moralischen Appell, mit andern zu teilen, hinausgeht. Gerade im Spannungsfeld mit Freiheit und Gleichheit wird deutlich, dass Solidarität eine eigene Dimension ist, die sich nicht in den beiden anderen auflösen lässt.
In seinem Ursprung verweist das Wort Solidarität auf eine von allen gemeinsam zu tragende „Schuld“ gegenüber der Gesamtheit aller Menschen. Hierbei hat jede und jeder Einzelne jeweils für das Ganze der Schuld einzustehen, dafür, dass sich Gesellschaftlichkeit am Gemeinwohl ausrichtet. Ausdruck von Solidarität sind folglich nicht alleine Rechtsansprüche, aus denen sich ein individueller Nutzen ziehen lässt, sondern gerade auch die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass solche Rechtsansprüche überhaupt erst möglich werden. Und zwar unabhängig davon, ob man selbst davon profitiert. Solidarität verträgt sich nicht mit einer geschäftsmäßigen Erwartung von Gegenleistungen.
Ihre Grundlage ist vielmehr eine prinzipielle Wechselseitigkeit, wie sie beispielweise in solidarisch finanzierten Sozialversicherungen – wenigstes von ihrer Idee her – angelegt ist. In solchen Solidargemeinschaften leisten alle Mitglieder nach ihrem individuellen Vermögen gestaffelte Beiträge, erhalten aber alle die gleichen Leistungen, gemessen allein am Bedarf. Jeder haftet für jeden, selbst Mittellose, die keinen Cent aufbringen können, werden versorgt. Nicht das Geben und auch nicht das Teilen, von dem heute so oft die Rede ist, begründen Solidargemeinschaften, sondern das Prinzip gegenseitiger Verantwortung. Verabschieden sich manche aus der Verpflichtung gegenüber den anderen, etwa indem sie sich privat versichern, bleibt die Verantwortung für das Ganze bei den verbliebenen Mitgliedern.
Das klingt reichlich abstrakt, und tatsächlich haben solche institutionalisierte Formen von Solidarität wenig gemein mit dem Bedürfnis nach unmittelbar erfahrbarer Solidarität, wie sie beispielsweise heutige Spendenplattformen suggerieren. Sie bieten aber genau jenen Schutz, der nicht erst verdient werden muss, der allen zuteil wird, unabhängig davon, ob man die Aufmerksamkeit anderer zu erreichen und sich als hilfsbedürftig zu präsentieren vermag. Es ist auch die Anonymität sozialer Sicherungssysteme, die Freiheit sichert.
Im Zuge der marktradikalen Umgestaltung der Welt ist die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in eine Schieflage geraten. Immer weniger sind es heute öffentliche Institutionen, die Schutz und Daseinsvorsorge bieten. Jeder und jede sei für sich selbst verantwortlich, so das neoliberale Credo, das vielen nicht ein Mehr an Freiheit, sondern nur eine Art Vogelfreiheit brachte. Die neoliberale Überhöhung von Eigenverantwortung hat sich als ein fataler Irrweg erwiesen. Auch die zuletzt zur Stärkung individueller Resilienz propagierten Selbstoptimierungsprogramme werden scheitern. Die Einzelnen, wie stark sie auch immer sind, werden sich alleine nicht vor den Folgen der voranschreitenden sozialökologischen Zerstörung schützen können.
Und so verwundert es nicht, dass zuletzt die Sehnsucht nach Solidarität wieder gewachsen ist. Umso wichtiger ist die Verständigung auf einen kritischen Begriff von Solidarität. Einen, der Solidarität nicht als Spleen von ein paar „Gutmenschen“ abtut, sondern in Solidarität die Voraussetzung für Demokratie sieht. Die Krise der Demokratie, die wir seit geraumer Zeit erleben, ist auch dem Mangel an Solidarität geschuldet. Wo die Einsicht in die Bedeutung gegenseitiger Verantwortung abhandenkommt, kann sich auch keine demokratische (Sozial-)Gesetzgebung entwickeln und können auch nicht die Institutionen entstehen, die der Freiheit erst die materielle Basis geben.
Die Krise der Demokratie ist vor allem eine Krise der herrschenden Politik. Sie zu lösen erfordert mehr, als sich gegen die Bedrohungen von rechts zur Wehr zu setzen. Notwendig ist das Wiedererlangen von Solidarität als Gesellschaftsform.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 1/2019. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!