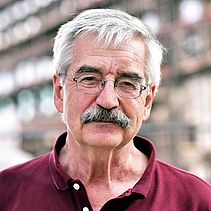Das derzeit teuerste Medikament der Welt heißt Zolgensma und kostet rund zwei Millionen Dollar pro Dosis. Zolgensma, das im Mai 2019 in den USA formell zugelassen wurde, verspricht Säuglingen, die unter genetisch bedingter spinaler Muskelatrophie leiden, eine dauerhafte Heilung und dem Schweizer Pharmakonzern Novartis ein Supergeschäft. Rund zwei Milliarden Dollar könnte Novartis in den nächsten drei Jahren mit dem Präparat erwirtschaften, heißt es in Kreisen von Börsenanalysten. Schon seit einigen Jahren steigen die Preise für Medikamente. Nun hat erstmals eines die Millionengrenze überschritten. Selbst finanzstarke Krankenkassen klagen über die horrenden Kosten moderner Gentherapie. Preise von mehreren Millionen Dollar seien zu hoch, um von der Gesellschaft getragen zu werden.
Die Konsequenzen einer offenbar nach oben offenen Preisspirale für das Gesundheitswesen sind enorm. Können wir uns unter diesen Umständen überhaupt noch Innovation leisten? Sind es in Zukunft vielleicht nur noch ein paar Superreiche, die vom medizinischen Fortschritt profitieren? Und was ist mit den Milliarden von Menschen, die im globalen Süden leben und weder über einen solidarisch finanzierten Versicherungsschutz noch über ein gut gefülltes Bankkonto verfügen? Verschärfen solche Innovationen, so sinnvoll sie für Einzelne sein mögen, nicht nur die eh schon in der Welt herrschende soziale Ungleichheit? Bedarf es nicht ganz anderer Innovationen?
Aufgrund der großen Nöte, die noch immer im globalen Gesundheitswesen zu beklagen sind, ist das politische Drängen auf Befreiung aus Not und Unmündigkeit weiterhin notwendig, das Bemühen um Erneuerung und Fortschritt nicht abgeschlossen. Aber nicht jede Innovation dient bekanntlich dem Wohlergehen der Menschheit. Als besonders problematisch erweisen sich Fortschrittsideen, wenn sie sich eine bessere Welt allein über einen wissenschaftlichen Erkenntniszuwachs erhoffen und Innovationen schließlich auf ökonomisch verwertbare technische Entwicklungen reduzieren. Das aber ist im Gesundheitswesen seit langem der Fall. Während hierzulande hochspezialisierte und überaus kostspielige Therapieverfahren erforscht werden, haben über zwei Milliarden Menschen noch nicht einmal den Zugang zu einfachen, aber überlebenswichtigen Medikamenten.
Mit Blick auf das eigentliche Ziel von Fortschritt – der Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratie – liegt in technischen Entwicklungen, wie sie Präparate wie Zolgensma symbolisieren, deshalb zugleich auch ein Rückschritt. Hochpreisige Pharmazeutika können der individuellen Selbstverwirklichung einiger weniger dienen, aber zugleich viele andere ausschließen. Letztere genießen zwar formal das gleiche Recht wie die anderen, werden aber aufgrund vielfältiger Umstände benachteiligt. Diesen paradoxen Zusammenhang hat der Sozialwissenschaftler Peter Wagner, Professor an der Universität Barcelona, zum Anlass genommen, um über die Wiedererlangung eines emphatischen Begriffs von Fortschritt nachzudenken. Nicht fehlendes Wissen ist heute dafür verantwortlich, dass das menschenrechtliche Versprechen auf ein würdiges Leben noch immer nicht erfüllt ist, sondern weltgesellschaftliche Verhältnisse, die von aufgezwungener Armut, verweigerter Anerkennung und der Fortexistenz post-kolonialer Vormacht geprägt sind.
Die Folgen dieser Missstände haben auch die Weltgesundheitsorganisation beschäftigt. Soziale Ungleichheit töte im großen Maßstab, befand sie in ihrem 2008 erschienenen Bericht über die sozialen Umstände, die Menschen krank werden und sterben lassen. Und weil das so ist, liege die Lösung der globalen Gesundheitskrise nicht in medizinisch-technischen Innovationen, sondern zuallererst in der Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen.
Es überrascht nicht, dass solche Einsichten in einer marktförmigen und von Renditeerwartungen bestimmten Wissensproduktion einen schweren Stand haben. Auch das Wissen um die soziale Determiniertheit von Gesundheit zählt im gesundheitspolitischen Mainstream heute wenig. Die Brisanz des WHO-Berichtes aber ist ungebrochen. Nicht in der Erforschung hochspezialisierter gentherapeutischer Verfahren liegt die Zukunft der Menschheit, sondern in überfälligen sozialpolitischen Veränderungen. Zu diesem Schluss kommen heute selbst Akteure, die nicht im Verdacht linker Ideologie stehen. Nur zu 15% sei Gesundheit durch kuratives ärztliches Handeln bestimmt, so die Unternehmensberatung McKinsey. Viel entscheidender seien die sozialen Lebensumstände und das Verhalten der Menschen.
Solche Studien bestätigen, was aus historischer Erfahrung längst bekannt ist. Die großen Erfolge, die im zurückliegenden Jahrhundert im europäischen Gesundheitswesen erzielt werden konnten, sind nicht mit Pillen und Hospitälern erreicht worden, sondern resultierten aus verbesserter Ernährung und Hygiene, würdigeren Arbeitsverhältnissen und dem Zugang zu einer öffentlich garantierten Daseinsvorsorge. Würden wir diese Einsichten ernst nehmen, wäre die Richtung, in der sich heute Innovation zu bewegen hätte, klar vorgegeben.
Ohne gesellschaftliches Miteinander, ohne solidarischen Ausgleich und demokratische Selbstbestimmung bleibt Gesundheit für die überwiegende Zahl der Menschen auf Dauer unerreichbar. Unbedingt ist alles zu vermeiden, was das Prinzip der Solidarität im Gesundheitswesen gefährdet. Jedem Fortschritt, der einer „individualistischen Utopie“ (Peter Wagner) huldigt, weil er nur die Selbstverwirklichung der Einzelnen im Blick hat, ist zu misstrauen. Die Befreiung aus Not und Notwendigkeit erfordert mehr als die Ausweitung von individueller Autonomie. Fortschritt verlangt heute ein sozialpolitisches Handeln, das auf die Stärkung von Räumen demokratischer Selbstverwaltung und die Schaffung jener gesellschaftlichen Einrichtungen zielt, ohne die die Verwirklichung der Menschenrechte unerfüllbar bleibt.
Die Frage, wie wir uns heute noch Innovation leisten können, ist also zuallererst die Frage, welche Innovationen wir für erforderlich halten. Folgen wir den allgemeinen Überlegungen von Peter Wagner, dann erweist sich Fortschritt im Gesundheitswesen nicht in der Entwicklung hochspezialisierter Arzneimittel, die für die Mehrheit der Menschen unerschwinglich bleiben, sondern in der Ausweitung von Räumen, in denen Menschen sich über die Erwartungen, die sie an ihr Gesundheitswesen richten, auseinandersetzen und einigen können. Der Gradmesser für Fortschritt liegt dann in der Entfaltung einer kollektiven Autonomie, wie sie in Ansätzen im selbstverwalteten deutschen Gesundheitswesen angelegt ist. Solche Räume zu stärken und zugleich ins Globale auszuweiten, steht für die Formen von Erneuerung, die heute gebraucht werden. Notwendig sind Innovationen jenseits von interessengeleiteter Wissensproduktion und ökonomischer Verwertbarkeit.
Und das könnte am Ende zum Wohle aller sein. Denn über die Stärkung demokratischer Selbstbestimmung wird sich auch jene politische Kraft herausbilden, die es womöglich nicht mehr länger hinnehmen wird, dass die Entwicklung von Arzneimitteln an die Überlassung eines zeitlich befristeten Monopols gekoppelt ist. Wohlwissend, dass die explodierenden Medikamentenpreise eine Folge der Patente sind, die Pharmakonzernen zu Amortisierung vermeintlicher Entwicklungskosten gewährt werden, obwohl bereits die medizinische Grundlagenforschung zu einem Großteil öffentlich finanziert wird, könnte eine selbstbewusste Öffentlichkeit auf die Idee kommen, die Entwicklung von Medikamenten insgesamt zu einem solidarisch finanzierten globalen Gemeingut zu machen. Unter solchen Umständen könnte schließlich auch ein technologischer Fortschritt wieder allen zugutekommen und so auch allen, die unter spinaler Muskelatrophie leiden, Heilung in Aussicht gestellt werden.