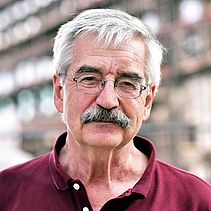In diesen Zeiten über die Chancen eines Weltbürgertums nachzudenken sei etwas für Optimisten, heißt es. Angesichts einer zuletzt wiedererstarkenden politischen Rechten und der Renaissance nationalistischer Abschottungspolitiken scheinen kosmopolitische Ideen tatsächlich aus der Zeit gefallen. Schauen wir aber genauer hin und über unsere Landesgrenzen hinaus, entdecken wir das Gegenteil. Nicht der Provinzialismus wächst in der Welt, sondern die Bereitschaft, aus einer globalen Perspektive auf das Zusammenleben aller zu blicken. Eine 2016 von der BBC durchgeführte Studie ergab, dass sich in Ländern wie Nigeria, China, Indien oder Peru über zwei Drittel der Befragten eher als Weltbürger:innen denn als Bürger:innen ihres Landes sahen, selbst in den USA waren es zwei von fünf. Rückläufig dagegen zeigt sich der Trend in Europa, nicht zuletzt in Deutschland. Ausgerechnet jene Länder, die ihren Wohlstand einer noch immer politischen, ökonomischen und kulturellen Dominanz über andere verdanken, drohen in provinziellem Populismus zu versinken.
Dabei haben kosmopolitische Ideen gerade in Europa eine lange Tradition. Schon Immanuel Kant ersann das Bild einer von internationalen Übereinkünften geeinten Welt. Sein Traktat „Zum Ewigen Frieden“ beeinflusste die Herausbildung des Völkerrechts und fand Eingang in die Charta der Vereinten Nationen. Vergleichbare Impulse gehen von Europa heute nicht mehr aus. Nur noch innerhalb ihrer Grenzen ist die EU um so etwas wie eine Kosmopolitisierung ihre Politik bemüht. Nach außen setzt sie auf überkommene Vorstellungen nationalstaatlicher Souveränität. Das Recht auf Freizügigkeit, das sie denjenigen, die innerhalb Europas leben garantieren will, untergräbt sie mit vorgelagerten Grenzkontrollen in Afrika. Das Bemühen um eine solidarische Verteilung von Impfstoffen innerhalb Europas steht in krassem Widerspruch zum Beharren auf Patenten, die Menschen in den armgehaltenen Regionen vom Zugang zu überlebenswichtigen Arzneimitteln ausschließen. So lassen sich die weltgesellschaftlichen Verhältnisse nicht gerecht gestalten. Die Hoffnung, den Geist der Globalisierung über abgeschottete Wohlstandsinseln wieder einfangen zu können, ist absurd.
Die Welt seit Kant hat sich verändert. Kosmopolitische Ideen werden heute nicht mehr in einer „Leserwelt“, in der einige Gelehrte (und es waren damals nur Männer) ihre Gedanken einem Weltpublikum vorstellen, verhandelt, sondern in der unmittelbaren Begegnung mit dem Fremden im Alltag. Im Zuge der Globalisierung ist die Welt näher zusammengerückt, das Zusammenleben von Menschen vielschichtiger geworden. Und so sind auch die Zeiten, in denen der Fortgang der Geschichte von europäische Sichtweisen dominiert wurde, vorbei.
Die Befreiung menschlicher Lebenswelten von ihren kolonialen Durchdringungen ist überfällig. Es gelte einen neuen Kosmopolitismus zu ersinnen, der nicht von eurozentristischen Perspektiven bestimmt ist, forderte unlängst der kamerunische Philosoph Achille Mbembe auf der medico-Konferenz „Die (Re)-Konstruktion der Welt“. Ohne die gegenseitige Respektierung der Anderen in ihrem Anderssein wird die Entwicklung eines neuen Gemeinsamen, eines „globalen Wir“, nicht gelingen.
Die Bedeutung eines Ethos des globalen Zusammenlebens ist schnell betont, seine Entfaltung eine große Herausforderung. Zuallererst gilt es die bestehenden Dominanzkulturen aufzubrechen, in die wir alle auf unterschiedliche Weise verstrickt sind. Wie sollen kosmopolitische Gerechtigkeitsideen zum Tragen kommen, wenn die Ideologie der kapitalistischen Lebensform tief in den Köpfen der Menschen eingegraben bleibt und nicht Solidarität, sondern Konkurrenz, nicht Gemeinwohl, sondern Eigennutz als erstrebenwert gelten? Wie können die unterschiedlichen Erfahrungswelten zueinanderfinden, wenn nur die jeweils eigene gelten soll? Wie soll sich der Gleichheitsgrundsatz durchsetzen, wenn Gleichheit mit Identität verwechselt wird? Und wie können die Menschenrechte einen Bezugspunkt für das globale Ethos bilden, wenn sie nicht immer wieder als Alibi für die Durchsetzung partikularer Machtinteressen missbraucht würden und deshalb von vielen Menschen im globalen Süden als Ausdruck einer weißen Dominanzkultur betrachtet werden?
In der heutigen Welt muss Kosmopolitismus notwendig ein kultureller Kosmopolitismus sein, einer, der eine Vision davon aufzeigt, wie einander fremde Menschen in ihrem Umfeld alltäglich zusammenleben können, ohne dabei die Sorge um die ganze Welt, die Lebenswelten aller, zu verlieren. So verstanden zielt Kosmopolitismus auf die Entfaltung einer von jeder und jedem Einzelnen getragenen Verantwortung füreinander, unabhängig von Nationalität, Sprache, Religion und Gewohnheiten.
Hiervon ist die Welt noch weit entfernt, auf bemerkenswerte Weise ist der bisherige Globalisierungsprozess unvollendet geblieben. Mit der Entfesselung des Kapitalismus ist die Welt zwar zu einem einheitlichen ökonomischen System integriert worden, politische und rechtliche Institutionen aber, die allen gleiche tätige Teilhabe sichern, sind nicht entstanden. Genau darum muss es heute gehen. Ohne Disziplinierung der global entfalteten Produktivkräfte wird es weder gelingen, das weltweite Krisengeschehen in den Griff zu bekommen, noch ein würdiges Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen. Das Drängen auf Gestaltung der globalen Verhältnisse meint nicht das Oktroyieren eines für alle geltenden Gesellschaftsmodells oder die Etablierung einer Weltregierung. Es meint das Ermöglichen vieler selbstbestimmter Lebenswelten, die einen von Solidarität und demokratischer Selbstbestimmung getragenen gemeinsamen gesellschaftspolitischen Rahmen haben. Das ist die Essenz des Artikels 28 der Menschenrechtserklärung. Sie bedeutet heute nichts anderes, als die Freiheitsrechte mit dem Bedürfnis nach sozialer Sicherung in eine Balance zu bringen, über alle Grenzen hinweg.
Radikale Veränderungen gelingen nicht von heute auf morgen. Was aber hindert uns daran, unser Drängen auf demokratische und soziale Rechte im eigenen Land schon heute ins Globale auszuweiten? Zum Beispiel durch die Forderung eines Weltbürger:innenrechts, das die Lücke zwischen den Rechten einzelner gegenüber den Pflichten ausländischer Mächte schließt. Als eigenständige Rechtssubjekte könnten die Opfer von Menschenrechtsverletzungen endlich auch Klage gegen weltweit tätige Konzerne oder intervenierende Militärs führen. Was spricht gegen eine Ausweitung der großen nationalen Rechtsrevolutionen des
18. und 19. Jahrhunderts und für eine globale Verfassung, mit der politisches Handeln überall an das Recht gebunden wird? Das mag utopisch klingen. Doch die Erfolge, die mit dem Biodiversitätsabkommen, dem Verbot von Landminen oder der Einrichtung eines Strafgerichtshofes erstritten wurden, zeigen, dass wir längst auf dem Weg zu einer Verrechtlichung der globalen Verhältnisse sind.
Wie Weltbürger:innenrecht auch im Lokalen gelingen kann, zeigt die im letzten Herbst in Zürich eingeführte „Züri City Card“. Viele Jahre haben Züricher Bürger:innen dafür gekämpft, dass alle in der Stadt wohnenden Menschen einen offiziellen Ausweis haben, ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Aufenthaltsstatus. Nun können sich auch Menschen ohne Papiere gegenüber lokalen Ordnungsbehörden ausweisen, können öffentliche Beihilfen in Anspruch nehmen, Wohnungen mieten, Verträge schließen und Bibliotheken sowie andere Einrichtungen der sozialen Infrastruktur nutzen. Das Recht, Rechte zu haben, das Recht auf Zugehörigkeit, ist in Zürich nicht mehr an eine Nationalstaatlichkeit gebunden; ein großartiger Schritt hin zu einer solidarischen Weltgesellschaft und Beleg dafür, dass es gar nicht so schlecht um kosmopolitische Ideen steht.
Abschied und Neuanfang

Thomas Gebauer war mehr als 40 Jahre lang bei medico beschäftigt und seit 1996 als Geschäftsführer des Vereins tätig. Die letzten zwei Jahre leitete er als Sprecher die stiftung medico international. Den „Utopischen Raum“ wird er gemeinsam mit Ramona Lenz, seiner Nachfolgerin, weiter mit gestalten. Seine Verbundenheit mit medico wird also auch seinen neuen Lebensabschnitt begleiten. Über eine so lange Zeit lässt sich in der Kürze hier nicht sprechen. Ein paar Stichpunkte seiner medico-Biografie lauten: Beteiligt am Aufbau der Solidaritätsbewegung mit Mittelamerika; Entwicklung des psychosozialen Arbeitsschwerpunktes; Aufbau einer transnationalen Öffentlichkeit, die u.a. mit der „Kampagne zum Verbot der Landminen“ 1997 den Friedensnobelpreis erhält; Entwicklung einer transnationalen Öffentlichkeit zum globalen Recht auf bestmöglichen Zugang zu Gesundheit; kritische Reflexion zur Wirkung von Hilfe; Ausarbeitung einer institutionellen Idee von transnationaler öffentlicher Infrastruktur u.v.m. Für medico im Generationswechsel bleibt die Aufgabe, den politischen Raum und das emanzipatorische Selbstverständnis weiterzuentwickeln, die medico trotz der Zeitläufe und der Entpolitisierung der Hilfe bewahrt hat. Thomas Gebauer trug dazu mit seinem Rüstzeug der Kritischen Theorie entscheidend bei und sorgte so dafür, dass medico nicht in einer selbstgewissen, auf die Verteidigung fixer Wahrheiten bedachten Nische landete.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 1/2021. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!