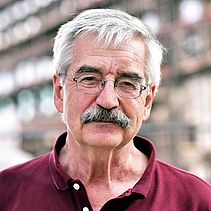Für Hollywood ist die Sache klar. Das Bild, das in der Verfilmung des Dan-Brown-Bestsellers "Inferno" von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gezeichnet wird, ist das einer technisch hochgerüsteten Spezialeinheit, die immer dann gerufen wird, wenn gefährliche Krankheitskeime die Sicherheit der Welt bedrohen. Im Film ist es eine Bio-Bombe, mit der ein verrückter Professor die Weltbevölkerung dezimieren will. In der Wirklichkeit ist es die Sorge vor außer Kontrolle geratenen Bakterien und Viren.
Der Schock , den der Ausbruch von Ebola ausgelöst hat, sitzt noch immer tief. Nicht nur Hollywood erträumt sich eine WHO, die sich auf das Identifizieren und Stilllegen von Infektionsquellen versteht. Auch die Politik denkt verstärkt darüber nach, wie die WHO für künftige Risiken besser gewappnet werden kann. Mitte Mai 2017 trafen sich in Berlin die Gesundheitsminister der G20, und um zu zeigen, wie ernst es ihnen mit der Schaffung robuster Notfallregime ist, probten sie mit einer simulierten Epidemie den Ernstfall.
Der Ebola-Schock
Die großen gesundheitlichen Herausforderungen der Zeit aber sind nicht neu. Sie werden nur sehr viel deutlicher auch hierzulande gespürt. Mit dem Auftreten von Ebola ist klar geworden, dass die prekären Zustände, die im globalen Süden herrschen, auf den Rest der Welt auszustrahlen beginnen. Armutsbedingte Krankheiten wie Tuberkulose, die im globalen Norden bereits überwunden schienen, kehren in dramatischer Form als resistente Keime zurück. Vor diesem Hintergrund ist es nicht unproblematisch, wenn in den gesundheitspolitischen Debatten heute verstärkt von "Health Security" (Gesundheitssicherheit) die Rede ist und mitunter gar die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels beschworen wird. Die Idee einer "Health for all" müsse durch "Global Health Security" ergänzt werden, einer neuen globalen Norm, die allein dazu geeignet sei, den bestehenden und künftigen Risiken Paroli zu bieten.
Angesichts einer zunehmend aus den Fugen geratenen Welt ist das Bedürfnis nach Sicherheit verständlich. Wer wäre in Zeiten wachsender Unsicherheit nicht für mehr Sicherheit? Schauen wir aber genauer hin, wird die Sache komplizierter. Unklar bleibt, was unter Sicherheit verstanden wird, wer Sicherheit definiert und wie sie geschaffen werden soll. Denn die staatliche Sorge um Gesundheit kann viele Beweggründe haben – gute wie schlechte: Sie kann dem universellen Menschenrecht auf Gesundheit verpflichtet sein und über Maßnahmen eines weltweiten Ausgleichs dafür sorgen, dass die gesellschaftlich bedingte Ungleichheit im Zugang zu Gesundheit reduziert wird. Sie kann aber auch nur den Schutz der jeweils eigenen Bevölkerungen im Auge haben und über gesundheitspolizeiliche Kontrollen und kurzfristiges Krisenmanagement dafür sorgen, dass sich die prekären Lebensverhältnisse, die in vielen Teilen der Welt herrschen, nicht auf die wohlhabenden Regionen auswirken. Sie kann das Ziel eines möglichst langen und möglichst gesunden Lebens verfolgen oder nur den Interessen der Wirtschaft dienen, für die Gesundheit längst zu einem einträglichen Geschäft geworden ist. Schon jetzt spekulieren Versicherungsunternehmen, Pharma-Multis und die medizintechnische Industrie auf die vielen Milliarden, die weltweit aus Steuermitteln bereitgestellt werden müssen, um den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN zu entsprechen.
Öffentliche Gesundheitsvorsorge ist nicht davor gefeit, für ökonomische und machtpolitische Interessen instrumentalisiert zu werden. Es ist noch nicht lange her, da gehörte die Sorge um die Gesundheit der Menschen zu den Aufgaben örtlicher Polizeiverwaltungen. Im preußischen Deutschland etwa war das erklärte Ziel von Public Health nicht, für Langlebigkeit oder Wohlbefinden der Einzelnen zu sorgen, sondern die Leistungsfähigkeit der ganzen Bevölkerung zu sichern. Später kam die Sicherstellung von Wehrfähigkeit hinzu, schließlich die wahnhafte Idee einer nationalsozialistischen Rassenhygiene.
Letztere scheint zum Glück überwunden, die Verortung von Public Health im Kontext gesundheitspolizeilicher Aufgaben nicht unbedingt. Hollywood zeigt es, aber eben auch der Umgang mit der Ebola-Krise, die es auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates schaffte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen wurde eine UN-Mission zur Bekämpfung einer Krankheit gebildet. Seitdem diskutieren Experten in aller Welt über die Einrichtung von Notfonds, die Bildung von schnellen Eingreiftruppen, von Weißhelmen, die Schaffung robuster Versorgungsstrukturen und resilienter Gesundheitssysteme.
Eindämmung von Risiken
All das ist ohne Frage vernünftig – im Sinne einer instrumentellen Vernunft; eine Vernunft, welche die Mittel, nicht aber die Ziele des Handelns reflektiert; die nicht die Frage verfolgt, wie die Risiken an ihrem Ursprung zu bekämpfen sind, sondern wie mit künftigen Risiken so umzugehen ist, dass sie den Status quo nicht bedrohen. Nicht die Kritik an den eigentlichen Ursachen der globalen Gesundheitskrise steht im Zentrum der Überlegungen, sondern die Frage, wie effiziente Krisenverwaltung möglich ist, ohne die eigentliche Krise angehen zu müssen. Die Marktradikalität mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen jedenfalls stand nicht auf der Tagesordnung der G20, auch nicht die Geschäfte der weltweit boomenden Extraktionswirtschaft, die immer mehr Menschen zur Abwanderung in unwirtliche und krankmachende Lebensumstände zwingt. Ebenso wenig ging es um die Praktiken der Nahrungsmittel- und Getränke-Multis, die längst zu einer massiven Bedrohung gesunder Ernährungsgewohnheiten geworden sind. Stattdessen stand die Frage im Vordergrund, wie die aus solchen Verhältnissen resultierenden gesundheitlichen Probleme möglichst früh identifiziert und eingedämmt werden können.
Und eben das macht den herrschenden Sicherheitsdiskurs so problematisch. Statt über die Ländergrenzen hinweg auf sozialen Ausgleich und Integration zu drängen, setzt sicherheitspolitisch ausgerichtete Politik auf die Absicherung des Bestehenden, und sei es noch so ungerecht. Der utopische Überschwang, der noch zur Gründung der WHO geführt hat, weicht so einem pragmatischen Realismus, der nur noch darum bemüht ist, bestehende Privilegien und die sie begründenden Machtverhältnisse abzusichern. Dabei droht genau das unter die Räder zu kommen, woran sich Politik eigentlich ausrichten sollte: das Recht und die Rechtsansprüche von Menschen, wie sie in den Menschenrechten und in der Verfassung der WHO niedergelegt sind.
Sicherheit als Partikularinteresse
Im Unterschied zu den Menschenrechten wird das Bemühen um Sicherheit nicht von der Idee der Universalität getragen. Wer von Sicherheit spricht, hat zuallererst die eigene Sicherheit im Blick – eine Sicherheit, die an bestimmte Territorien oder Privilegien gebunden ist. Die gegenwärtigen sicherheitspolitischen Strategien zielen nicht unbedingt auf den Schutz derjenigen, die am meisten der sozialen Sicherung (protection) bedürfen – die Armen und Mittellosen –, sondern in aller Regel auf die Abschirmung (security) von Besitzständen, auf die Sicherheit der Bessergestellten, genauer: auf die Absicherung jener imperialen Lebensweise, die einige auf Kosten anderer führen.
Es ist höchste Zeit, dieses absurde Zusammenspiel zu durchbrechen. Denn die Risiken, kommen nicht eigentlich von außen, sondern von innen. Und bei aller Notwendigkeit, Krankheiten zu bekämpfen, darf nicht übersehen werden, dass die großen gesundheitlichen Verbesserungen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten, z.B. in Europa erzielt wurden, nur zu etwa einem Drittel auf eine verbesserte Krankenversorgung zurückzuführen sind. Bedeutender als kurative Versorgungsangebote waren und sind gesellschaftliche Faktoren wie der Zugang zu Einkommen, angemessene Wohnverhältnisse, sauberes Trinkwasser, würdige Arbeits- und intakte Umweltbedingungen, und nicht zuletzt Bildung und gute Ernährung.
So verstanden gründet sich Gesundheit auf soziale Gerechtigkeit und zivilgesellschaftliche Teilhabe. Das ist die Lehre, die auch aus den Erfahrungen in der Bekämpfung von Epidemien zu ziehen ist. Nicht zuletzt in der Ebola-Krise wurde deutlich, welche Kraft im zivilgesellschaftlichen Engagement steckt. Ohne die Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit, die von Selbsthilfegruppen vor Ort geleistet wurde, ohne die Einbeziehung der Betroffenen, die alleine in der Lage sind, in ihren jeweiligen Lebenswelten glaubwürdig aufzutreten, wäre auch der Einsatz all der aus dem Ausland entsandten Helfer vergeblich gewesen.
Eine am Recht auf Gesundheit ausgerichtete öffentliche Gesundheitspflege verlangt weniger nach Vorschriften und Überwachung, sondern nach Selbstverwaltungen und Entscheidungsteilhabe. Die alles entscheidende Frage ist, wie die Bekämpfung der sozial bedingten Ungleichheit im Zugang zu Gesundheitschancen gelingt. Mit Blick auf die realen Mängel, die in vielen Teilen der Welt bestehen, mag ein solcher Ansatz utopisch klingen. Genau darum aber geht es: um die Formulierung einer Vision, die aus dem Elend herausführt und es nicht nur weiter verwaltet.