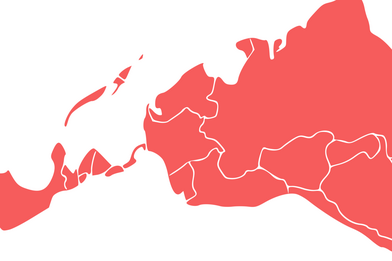Der Austausch zwischen medico und seinen Partnerorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika findet auf regelmäßigen Reisen der medico-Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren und unregelmäßigen Reisen der Zuständigen in der Öffentlichkeitsarbeit in die Projektregionen statt. So wird eine kontinuierliche Zusammenarbeit gewährleistet.
Aktuell nutzt medico sein Jubiläumsjahr, sich über solch bilaterale Treffen hinaus mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Partnerorganisationen zusammen an den Tisch zu setzen. Im Februar 2018 fand im brasilianischen Salvador da Bahía das erste medico-Regionalforum statt, zu dem Partner aus El Salvador, Nicaragua, Venezuela und Brasilien eingeladen waren. Weitere Foren sind im Laufe des Jahres in Afrika, im Nahen Osten und in Südasien geplant.
Nachstehend zwei Einschätzungen der Forumsdebatte – die erste von Moritz Krawinkel von medico, die zweite von Antonio Martins aus Brasilien.
Kritische Solidaritäten
Von Moritz Krawinkel
Beim Premierenforum lag der Fokus auf dem Aufstieg und Niedergang der sogenannten progressiven Regierungen in Lateinamerika in den vergangenen 20 Jahren – und der Frage nach der (bleibenden) Bedeutung dieser Ära. So hieß es in unserer Einladung: „(Auch) Lateinamerika rückt nach rechts. Sei es durch originär rechte Parteien oder rechte Tendenzen in vermeintlich progressiven Regierungen, die den Extraktivismus fortsetzen, den Sozialstaat (wieder) demontieren, indigene und andere marginalisierte Gruppen zur Seite drängen.“ In die Bilanz müssen jedoch auch die Erfolge einbezogen werden: Armutsbekämpfung, Erfolge im Gesundheitsbereich und ein kaum zu ermessender Schub für das Selbstwertgefühl der Armen.
Für eine Einführung konnten wir den venezolanischen Soziologen Edgardo Lander gewinnen. Er betonte, dass Lateinamerika am Ende einer Epoche nicht mehr der „Kontinent der Hoffnung“ sei, der mit den neuen Verfassungen in Ecuador, Bolivien und Venezuela neue Horizonte eröffnet habe. Ohnehin seien von Anfang an viele Projektionen im Spiel und die progressiven Regierungen widersprüchliche Projekte gewesen. Die „Pluri-Nationalität“ beispielsweise, wie sie in der ecuadorianischen Verfassung festgeschrieben worden war, spiegelte zwar die Vielfalt der Bevölkerung des Landes wider, stand aber immer im Widerspruch zur nationalstaatlichen Verfasstheit des Projektes. Auch in den Bereichen der Armutsbekämpfung und der Integration vormals Ausgeschlossener hat es Edgardo zufolge große Fortschritte gegeben. Mit den Überschüssen aus den Exporterlösen sei eine gute Verteilungspolitik gemacht worden – aber eine Umverteilung habe es faktisch nicht gegeben. Der fortgesetzte Extraktivismus habe zudem die Abhängigkeit vom Weltmarkt noch verstärkt und am meisten hätten ohnehin die wirtschaftlichen Eliten vom Aufschwung profitiert. Die Ungleichheit sei nicht kleiner geworden. Érika von der Bewegung der Arbeitenden ohne Dach (MTST) ergänzte, dass die progressiven Regierungen in einem Krisenmoment auch für das Kapital die beste Wahl gewesen seien.

Was bedeutet das für gesellschaftliche Veränderung? Vermutlich muss die progressive Epoche als Teil eines längeren Prozesses gesehen werden, der neben Fortschritten auch Phasen mit Rückschlägen beinhaltet. Versteht man Revolution nicht als singuläres Ereignis, sondern als langwierigen Prozess der Veränderung von Praktiken, Kulturen und Lebensweisen, öffnet das den Raum für Zwischentöne. Deshalb darf, so Edgardo, das Erreichte unter keinen Umständen vergessen werden, bietet es doch eine Grundlage für zukünftige Emanzipationsprojekte.
Der Blick auf die experimentellen, mutigen und lehrreichen Ansätze des Neuen im Bestehenden schlägt eine Brücke zwischen den Debatten um die „imperiale Lebensweise“, und den „Inseln der Vernunft“, als die wir die Projekte unserer Partner nicht nur in Lateinamerika gerne bezeichnen. Auf dem Regionalforum waren die Verbindungen zwischen den hiesigen Diskussionen und der Arbeit unserer Partner immer präsent. Auch der enge politische Zusammenhang zwischen den vielfältigen Projekten unserer Partner in der Region – zum Beispiel einem alternativen Debattenportal, der Stärkung lokaler Gesundheitsversorgung, dem Recht auf Stadt und dem Kampf um Landrechte oder gegen autoritär durchgesetzte Megaprojekte – war offensichtlich. Das ermöglichte eine gemeinsame Diskussion, ausgehend von zum Teil sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten und Erfahrungen. Henry vom Nationalen Gesundheitsforum in El Salvador betont die Notwendigkeit des Austauschs: „Tatsächliche Änderung kann es nur geben, wenn man über den Tellerrand hinausblickt.“
Das Forum war ein Ort für Diskussionen, die in der konkreten Zusammenarbeit oft zu kurz kommen. So entspann sich um den Begriff der Solidarität eine angeregte Debatte, als Edgardo die Solidarität vieler Linker mit Venezuela kritisierte. Der brasilianischen Landlosenbewegung MST warf er vor, ihre antiimperialistische Positionierung käme einer Solidarisierung mit der Regierung Maduro gleich, nicht aber einer Solidarität mit dem venezolanischen Volk. Ísis vom MST verteidigte zwar die Solidarisierung mit dem „bolivarischen Prozess“, war aber offen für Treffen auch mit anderen venezolanischen Akteuren. Bei allen Unterschieden in den konkreten Positionierungen, herrschte doch Einigkeit darüber, dass Solidarität nur als kritische hilfreich und als solche überlebenswichtig für soziale Bewegungen und Transformationsprozesse ist. In diesem Kontext betonten alle Teilnehmenden die besondere Beziehung zu medico als einer Organisation, die ihre Unabhängigkeit als politische Akteure respektiere.
Würze für neue Träume
Von Antonio Martins
Das große Fenster des Sitzungsraums geht hinaus auf den Rio-Vermelho-Strand in Salvador. Der Ausblick war also großartig – im Gegensatz zu den Umständen. Das Treffen der lateinamerikanischen medico-Partner war geprägt von einer Bilanz, die Edgardo Lander angesichts der Krise der „Progressismen” in der Region zog. Er zeigte auf, wie die Rückeroberung der Macht durch die Rechte (durch Wahlen oder im Staatsstreich) in direkter Verbindung steht zu den riesigen Defiziten eines Projekts, das die Welt beinahe zwanzig Jahre lang faszinierte. Ja, die Regierungen unter Lula (Brasilien), Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivien), Rafael Correa (Ecuador) oder Nelson und Cristina Kirchner (Argentinien) haben. so Edgardo, Menschen im zweistelligen Millionenbereich aus tiefster Armut geholt. Schüchterne Ansätze für ein Bürgereinkommen haben aufgezeigt, dass das Recht auf ein würdiges Leben nicht zwangsläufig mit Lohnarbeit verbunden sein muss. Auch war Lateinamerika zwei Jahrzehnte lang nicht mehr der „Hinterhof Washingtons“, sondern hat sich untereinander geeint und an geopolitisch gewagten Projekten wie den BRICS beteiligt.
Aber keines der Länder hat Edgardo zufolge in diesem „fortschrittlichen Zyklus“ die Schraube weit genug gedreht. Der Kernder Kolonialverhältnisse sei nicht angetastet worden. Fasziniert von der eurozentrischen Begrifflichkeit „Fortschritt“ waren die neuen Regierungen unfähig, das Verhältnis ihrer Gesellschaften zur Natur, zu Produktion von Reichtum für den globalen Markt und vor allem zu sich selbst zu hinterfragen. Das Fortschrittsmodell sei das trojanische Pferd in den emanzipatorischen Projekten Lateinamerikas.

Der Kontinent ist ein großer Rohstoffproduzent geblieben, vom venezolanischen Erdöl über die brasilianischen Erze bis zum argentinischen Getreide. Der Preis dafür war die Fortführung von Umweltzerstörung und einer rückwärtsgewandten Idee. Auch die Progressiven verfolgten Megaprojekte, setzten gigantische Berg- und Wasserkraftwerke. Die ländlichen Gebiete verkamen weiterhin zu entmenschlichten „grünen Wüsten”. Vor allem aber blieb die Natur in der Wahrnehmung weiterhin etwas Feindliches, das der Mensch „zähmen“ muss, um herauszukommen aus seiner Lage des „Primitiven“, „Wilden“, „Nicht-Weißen“. Bis Anfang der 2010er Jahre wurde diese Vorstellung befeuert von einem weltweiten Boom der Rohstoffpreise. Wachsende Exporterlöse ließen ein Gefühl von Wohlstand entstehen und milderten soziale Spannungen. Man konnte den Massen helfen, ohne den Reichtum der Oligarchien anzutasten. Tiefere strukturelle Reformen – der Besitzverhältnisse im Agrarbereich und in der Stadt, des Steuersystems, der Demokratisierung der Medien – wurden aufgeschoben. Als die weltweite Krise die Feier beendete, war es den alten Eliten ein Leichtes, die Macht wieder an sich zu reißen und die politische Agenda zurückzudrehen.
Die Kaffeepausen beim Partnertreffen fanden im Wind vor dem Meer von Bahia statt. Bei einer dieser Gelegenheiten musste ich daran denken, wie Karin Urschel und Moritz Krawinkel von medico von den Anfängen der Organisation und dessen Verbindungen zu 1968 erzählt hatten. 50 Jahre sind seit dieser weltweiten Bewegung des Widerspruchs vergangen, die auch in Brasilien ihren Ausdruck fand. Sie scherte sich nicht um Nationalgrenzen und zielte auf eine Gesellschaft, die über das herrschende Wachstumsmodell hinausgeht. So wie die Hoffnungen Lateinamerikas liegen auch die vom Mai 1968 seit Jahrzehnten im Dämmerschlaf. Ob sie dort reifen? Beide sind teilweise gekapert worden. Die in den 1968er-Bewegungen so gegenwärtige Ablehnung von Hegemonie und Vertikalität wurde vom Neoliberalismus so umgedeutet wie es Margaret Thatcher einst formulierte: Es gebe „keine Gesellschaft, sondern nur Individuen“. Und hat nicht die Ablehnung der Herrschaft von Nationalstaaten eine Globalisierung hervorgebracht, in der die tatsächliche Macht längst nicht mehr die Regierungen sind, sondern das anonyme Gesicht transnationaler Konzerne?
Drei Monate nach dem Partnertreffen lese ich einen Text von Thomas Gebauer über 50 Jahre medico. Er sagt: „Das Verbindende solcher ‘Inseln der Vernunft’ ist die Idee einer anderen Globalität – einer Lebensweise, die sich auf Mitgefühl, Neugier und Kreativität stützt. Und in eben diesen Widersprüchen werden auch die Möglichkeiten von Emanzipation sichtbar.” Die Worte erinnern mich an kreative Erfahrungen, von denen in Salvador auch berichtet wurde – und an viele andere, die überall in Lateinamerika hochkochen: in Nicaragua Projekte in der sandinistischen Tradition, ohne dabei deren Fehler zu wiederholen; in Brasilien Erfahrungen mit emanzipatorischen Gesundheitsbegriffen aus den Besetzungen der Landlosen- und Obdachlosenbewegung.
„Wir alle sind Marcos” hieß es vor dreißig Jahren auf T-Shirts, die sich über die Welt verbreiteten. Sie trugen das Gesicht eines Guerilleros und Dichters, der im lakandonischen Urwald von Mexiko zu den Waffen griff und unmittelbar nach dem Zusammenbruch des primitiven Sozialismus neue Hoffnungen weckte. Die Begegnung der Partner in Salvador zeigte, dass wir noch leben; dass neue Verbindungen entstehen zwischen Lateinamerika und denen, die in Europa mit dem Blick des globalen Südens denken; und dass unsere Unzulänglichkeiten und zeitweisen Niederlagen vielleicht nur die Würze sind für neue Träume.
Übersetzung: Michael Kegler
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 2/2018. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. <link verbinden abonnieren>Jetzt abonnieren!