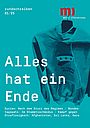Was auch immer die Verhandlungen über eine Regierungsbildung in Berlin bringen werden, eines ist schon jetzt absehbar: Die internationale Zusammenarbeit wird keine Priorität haben. Die Etats für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit (EZ) werden aller Wahrscheinlichkeit nach stark zusammengekürzt. Überraschend kommt das nicht. Seit vielen Jahren werden Projekte aus dem Bereich vor allem aus rechtspopulistischen Kreisen diffamiert – Stichwort „Radwege in Peru“ – und delegitimiert. Schon in den letzten Jahren sind Bundesetats für humanitäre Hilfe und EZ bereits mehrfach gekürzt worden. Im letzten Haushaltsentwurf der Ampel-Regierung wurden sie noch einmal massiv reduziert, die Gelder für die humanitäre Hilfe sogar um die Hälfte. Die Prognosen für die Etatentwicklungen in den kommenden Jahren werden im aktuellen politischen Klima immer düsterer. Auch eine Abschaffung des Entwicklungsministeriums (BMZ) oder eine Eingliederung desselben in das Auswärtige Amt stehen mal wieder zur Debatte. Gleichzeitig werden die bereits gestiegenen Etats für Sicherheit und Verteidigung voraussichtlich weiter anwachsen. Von der Vereinbarung aus dem letzten Koalitionsvertrag, die die Ausgaben für Verteidigung und internationale Hilfe aneinander koppeln wollte, ist nichts mehr übriggeblieben.
Doch es geht nicht allein um die Höhe der Etats – es geht auch um die Art ihrer Verwendung. Im Wahlkampf waren sich die Parteien der „politischen Mitte“ weitgehend einig, dass EZ-Gelder künftig primär nach ihrem Nutzen für deutsche Interessen vergeben werden sollen. Auch das ist nicht neu. Gerade die EZ wird seit Jahrzehnten als Instrument der „soft power“ im Einklang mit deutschen außenpolitischen Interessen genutzt – unabhängig davon, welche Partei gerade das zuständige Ministerium besetzt. Unter FDP-Minister Niebel sind sogenannte „Public Private Partnerships“ als Türöffner für deutsche Unternehmen populär geworden. Unter CSU-Minister Gerd Müller wurden Mittel der EZ nach 2015 für Grenzsicherung und Migrationsabwehr umgewidmet. Und bis zuletzt hat Svenja Schulze von der SPD immer wieder den Nutzen der EZ als Instrument zur Sicherung des deutschen Zugangs zu Rohstoffen betont.
Hilfe? Nur wenn es nutzt
Im aktuellen Diskurs hat sich diese Ausrichtung hin zum Eigennutz noch einmal verschärft. Unverhohlen wird Hilfe inzwischen ganz selbstverständlich zur Absicherung des wirtschaftlichen Einflusses und zur Abwehr von Migration in Dienst genommen. Hinzu kommt: Selbst die humanitäre Hilfe, die bislang stets als moralisch orientiert und „unpolitisch“ verhandelt wurde, soll jetzt an nationalen Interessen ausgerichtet werden. Das wird zur Folge haben, dass bei voraussichtlich stark schrumpfenden Haushaltsetats nur noch solche Kontexte eine Chance auf weitere Unterstützung haben, die entweder für die Externalisierung von Migrationsabwehr, die wirtschaftliche Zusammenarbeit oder zur Sicherung des geopolitischen Einflusses der Bundesregierung oder des Zugriffs auf Rohstoffe interessant sind. Alle anderen Regionen und „vergessenen Krisen“ dürften noch weiter in den Hintergrund rücken und zunehmend sich selbst überlassen bleiben.
Die zu erwartenden Kürzungen und Konditionierungen von öffentlicher EZ und humanitärer Hilfe ebnen nicht nur den Weg hin zu einer Abkehr von historischen Verantwortlichkeiten, die aus der Kolonialgeschichte entstanden sind. Sie bedeuten auch eine Abkehr vom Globalen. „Germany first“ wird zur Antwort auf eine sich verändernde, multipolare Weltordnung und zu einem verzweifelten Versuch, westliche Hegemonie aufrechtzuerhalten. Trump macht vor, wie das gehen kann. Mit seiner Entscheidung, die United States Agency for International Development (USAID) abzuwickeln, steigt der bisher größte Geber für humanitäre Hilfe weltweit faktisch aus der Hilfe aus. Auch USAID hat schon immer außenpolitische Interessen und keineswegs nur humanitäre Ziele verfolgt. Gleichwohl hat die Behörde über Jahrzehnte einen immensen Beitrag zur internationalen Finanzierung von Hilfsprogrammen geleistet. Durch das Vorgehen der Trump-Administration brechen rund 42 Prozent der bisherigen globalen Finanzierung für die humanitäre Hilfe weg.
Die Konsequenzen sind tödlich
Wenn nun auch noch die Bundesregierung, die neben den USA und der EU zu den größten drei Gebern von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe gehört, ihre Etats weiter kürzt und an Bedingungen knüpft, wird sich die Situation in vielen Krisen- und Katastrophenkontexten weiter verschärfen. Das gilt umso mehr, weil nun auch die EU-Außenbeauftragte wenige Tage nach dem Kahlschlag bei USAID ankündigte, sich dem neuen Kurs anzuschließen und EU-Hilfsgelder künftig bevorzugt zum Ausbau des eigenen geopolitischen Einflusses einzusetzen. Im Zentrum steht nicht der Bedarf vor Ort, sondern das blanke Eigeninteresse der Geberländer.
Welche dramatischen Auswirkungen diese fast gleichzeitigen Entwicklungen haben werden, lässt sich nur erahnen. Allein von dem Stopp von USAID sind vermutlich mehr als 120 Millionen Menschen weltweit betroffen. Inmitten akuter humanitärer Krisen fallen schlagartig Leistungen wie medizinische Hilfe, Nahrungslieferungen und Trinkwasserversorgung weg. Bisherige Fortschritte in der Ausrottung von Krankheiten, in der Ernährungssicherung, der Armutsbekämpfung oder der Abmilderung von unmittelbaren Auswirkungen der Klimakrise sind akut gefährdet. Für viele Menschen in Krisen- und Katastrophenkontexten wird das den Kampf ums Überleben bedeuten – oder den Tod. Auch medico-Partnerorganisationen berichten von den dramatischen Auswirkungen, sei es in Afghanistan, wo USAID fast die Hälfte aller humanitären Programme finanziert hat, oder im östlichen und südlichen Afrika, wo durch den Stopp von Gesundheitsprogrammen und Medikamentenlieferungen ganze medizinische Versorgungsstrukturen zusammenbrechen.
Mittelfristig betrifft die Kürzung und Konditionierung von Hilfsgeldern aber auch das Überleben von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren weltweit, u.a. von Hilfsorganisationen, Medienprojekten, Gesundheitsarbeiter:innen, Klimaaktivist:innen oder Menschenrechtsorganisationen. Diese sind oftmals nicht nur für die Umsetzung ihrer Aktivitäten, sondern auch für die Finanzierung der eigenen Strukturen auf externe Finanzierung angewiesen. Allgemein wird der Kurswechsel der aktuell größten Geber neokoloniale Ausbeutungsstrukturen verfestigen und Zivilgesellschaften entmachten. Besonders bedrohlich wirkt sich das auf diejenigen aus, die sich in autoritären Kontexten für die Verteidigung von Menschenrechten einsetzen und für strukturelle Veränderungen kämpfen. Die Auswirkungen werden aber nicht nur im globalen Süden zu spüren sein. Auch hierzulande wird sich der Kampf in der Konkurrenz um knapper werdende öffentliche Gelder verschärfen. Die Erfahrung lehrt, dass damit Opportunismus und Entpolitisierung zunehmen dürften.
In Zeiten des internationalen Rechtsrucks ist das nicht nur eine gefährliche Konsequenz, sondern vielmehr Teil einer autoritären Konjunktur. Die Delegitimierung von Hilfe und die damit einhergehende Schwächung der internationalen progressiven Zivilgesellschaft ist Ziel eines globalen rechten Hegemonieprojektes, das behauptet, humanitäre Krisen seien selbstverschuldet, das die Klimakrise leugnet und die universelle Gültigkeit von Menschenrechten infrage stellt. Gleichzeitig öffnet diese Delegitimierung Türen für eine vermehrte Einflussnahme von privatem Kapital – und verstärkt damit auch neokoloniale Abhängigkeiten und die weltweite Neoliberalisierung von Hilfs- und Versorgungsstrukturen.
Gegen all das braucht es Widerstand von unten. So darf es in den nächsten Monaten und Jahren nicht nur darum gehen, die Kürzungen und Konditionierungen von öffentlicher Hilfe zu kritisieren und die künftige Bundesregierung an ihre historische Verantwortung und ihre internationalen Verpflichtungen zu erinnern. Vielmehr müssen die Ressourcen und Räume einer kritischen, transnational agierenden Zivilgesellschaft aktiv geschützt werden. Der alte medico-Grundsatz „Hilfe verteidigen, kritisieren, überwinden“ gilt nach wie vor. Unter den aktuellen Umständen ist er allerdings besonders dringlich.
Die Kürzungen staatlicher Budgets verstärken eine Entwicklung, in der das Recht auf Hilfe zunehmend infrage gestellt wird. In einer Welt des Krieges und der Dauerkatastrophe sind Solidarität und die Stärkung der Selbsthilfe umso wichtiger. Genau dafür steht medicos Ansatz einer kritischen Nothilfe und unsere Zusammenarbeit mit einem weltweiten Partnernetzwerk. Damit wir dies in größtmöglicher Unabhängigkeit tun können, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Jede Spende ist zweierlei: Sie ist ein Beitrag, der unsere Arbeit finanziell ermöglicht. Und sie ist ein Zeichen gegen die Gleichgültigkeit in einer verrohenden Welt.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 01/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!