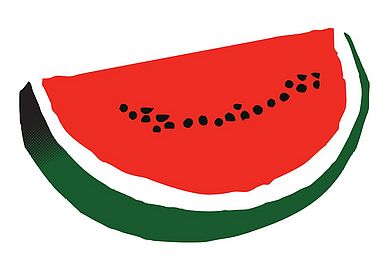Als medico vor 21 Jahren den Aufruf „Zeichen paradoxer Hoffnung“ zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen in Israel und Palästina veröffentlichte, war das Echo groß. Ein ganzes Rundschreiben versuchte sich damals in der vielfältigen psychoanalytischen und philosophischen Beschreibung des Konflikts. Heute wirkt das Wort Konflikt hingegen unangebracht. Denn ein Konflikt setzt halbwegs ebenbürtige Gegenüber voraus. Schon damals war Israel den Palästinenser:innen militärisch überlegen. Die Selbstmordattentate, die ja auch nur noch das letzte Mittel darstellten, waren dafür der beredte Ausdruck. Inzwischen ist aus der bereits seit dem Krieg von 1967 offenkundigen Asymmetrie zwischen Israel und den Palästinenser:innen allerdings eine totale politische, militärische und ideologisch-moralische Überlegenheit Israels geworden.
Seither sind wir Augenzeug:innen einer politischen Entwicklung in Israel, die mit illiberaler Demokratie nur ungenügend beschrieben ist. Die israelische Soziologin Eva Illouz hat in ihrem gerade erschienenen Buch „Undemokratische Emotionen: Das Beispiel Israel“ diese politische Veränderung aufrüttelnd beschrieben. Sie untersucht den Aufschwung der Rechtspopulist:innen in Israel als Fallstudie, die für diesen aktuellen politischen Trend weltweit von Relevanz ist. Der am längsten regierende Populist ist nämlich Netanjahu. Die Ingredienzien seines politischen Stils sind laut Illouz prägendes Vorbild weltweit: betont maskulin, den Rechtsstaat und etablierte demokratische Institutionen angreifend, auf Verschwörungstheorien über einen tiefen Staat setzend. Es gewinnen, so Illouz, politische Emotionen an Einfluss, die nicht Demokratie, sondern Autoritarismus begründen: „Angst, Abscheu, Ressentiment“. Diese negativen Gefühle seien zugleich in der „Liebe zur Nation oder zum jüdischen Volk aufgehoben“, die gegen die anderen, insbesondere die Araber:innen als Feind:innen, konstruiert werde. Die Rede ist also von einem ethno-religiösen und versicherheitlichten Nationalismus, der in Israel hegemonial geworden ist. Zum 75. Jubiläum der Gründung des Staates, der Jüdinnen und Juden aus Europa tatsächlich eine Zuflucht nach dem Holocaust bot, ist das eine Tragödie.
Geografie der Fragmentierung
Wer lange bei medico arbeitet, hat das Glück, Menschen kennenzulernen, deren politische Haltung und persönlicher Einsatz für das Menschenrecht eine tiefe Ehrfurcht hervorrufen. So einer ist Yehuda Shaul. Der Gründer von Breaking the Silence, der Organisation ehemaliger israelischer Soldat:innen, die Zeugnis über Menschenrechtsverletzungen der israelischen Armee ablegen, ist ein wuchtiger Mann mit langsam ergrauendem Haar und Vollbart. Sein amerikanisches Englisch dröhnt laut und manchmal pathetisch über die Hügel de lisch-palästinensischen Landschaft hinweg. Er hätte einen guten Rabbi abgegeben, wenn es so gekommen wäre, wie seine streng religiösen Eltern es für ihn vorgesehen hatten. Seit er als Soldat in Hebron diente, kennt er jedoch keine andere Aufgabe, als die israelische Besatzung zu kritisieren, zu analysieren und allen, die es hören wollen, mit ihren immer weiter eskalierenden Formen der Gewalt zu beschreiben.
Inzwischen hat Shaul sich tief in die Geschichte der Besatzung von 1967 bis heute hineinbegeben, Breaking the Silence macht mittlerweile ohne ihn weiter. Ausgerüstet mit Landkarten und Regierungsdokumenten, die bis in die Zeit kurz nach Ende des Krieges von 1967 reichen, treffen wir ihn auf einer Anhöhe am Rande von Jerusalem. Als Ergebnis dieses Krieges kontrollierte Israel das Westjordanland einschließlich Ostjerusalem, den Gazastreifen sowie den Sinai und die Golanhöhen. Es habe, so Yehuda, keinen wirklichen Plan gegeben, nur die Befürchtung, die USA würden Israel schnell zum Rückzug zwingen. Yehuda blättert in den Plänen, die er auf einen Tisch unter einem Baum legt, und zeigt, wie bereits 1967 Siedlungspolitik das wesentliche Element war, um die von Palästinenser:innen bewohnten Teile Ostjerusalems immer weiter einzukreisen und die Stadt vom Rest der Westbank abzuspalten. In der Siedlungspolitik sieht Yehuda eine Kontinuität von 1967 bis heute. Immer wieder zeigt er uns auf den Karten und später auch im Augenschein die Allon-Straßen. Der damalige Verteidigungsminister der Arbeitspartei, Jigal Allon – im Wikipedia-Eintrag gilt er als linker Zionist –, hatte bereits die Pläne für die Straßenführungen in den besetzten Gebieten ausgearbeitet. Sie waren strategisch so angelegt, dass sie das Westjordanland zerteilen und von Jordanien abschneiden. Die umgehend in Angriff genommenen Siedlungen waren strategisch geplant, um die Kontrolle der Gebiete dauerhaft zu sichern.
Mittlerweile dominieren radikal-religiöse Siedler:innen das Geschehen. Wir stehen auf einer Anhöhe in der Westbank. Hier liegt die Siedlung Ofra. Kaum sind wir ausgestiegen, erscheint ein blaues, ziemlich heruntergekommenes Auto. Ein wenig vertrauenswürdiger Siedler mit Kippa, Gebetsriemen, Dreitagebart und abgewetzten Hosen sowie einer Waffe an der Schuler fragt herausfordernd, was wir hier wollten. Yehuda kennt das schon und wehrt ihn ab. Trotzdem bleibt der Mann stehen und telefoniert. Offenbar gehört er zu einer privaten Siedler-Miliz. Der rechtsradikale Minister Itamar Ben Gvir macht sich jetzt daran, eine ähnliche Miliz mit besonderen Befugnissen gegen die palästinensischen Staatsbürger:innen Israels im Kernland aufzubauen. Die Drohgebärde des bewaffneten Siedlers ist beeindruckend. Er tritt auf wie der unwidersprochene Herr und Gebieter des Territoriums.

Radikale Siedler:innen wie er verfolgen beständig nur das eine Ziel, den Palästinenser:innen so viel Territorium wie möglich abzunehmen und die darauf lebende Bevölkerung zu verdrängen. Ihre Minister setzen offen auf einen Krieg, den sie als Anlass nutzen könnten, die Palästinenser:innen vollständig aus der Westbank zu vertreiben. Während wir weiter durch das hügelige Gebiet fahren und in der Ferne Jordanien mit seinen kargen Felsen blau dämmert, beobachten wir drei ultraorthodoxe Jugendliche, die mit Steinschleudern auf einen palästinensischen Bauern zielen. Später werden uns palästinensische Kollegen erzählen, dass sie nicht mehr allein auf ihre Felder gehen können, weil sie regelmäßig tätlich angegriffen werden. Yehuda zitiert den rechtsradikalen Minister Smotrich, der die palästinensische Hoffnung auf eine einvernehmliche Friedenslösung ausmerzen möchte. Shaul gibt uns zum Schluss noch nachdrücklich eine Botschaft mit, die sich vor allen Dingen gegen ein Missverständnis europäischer Regierungen richtet: Man könne zwischen Siedlerbewegung und israeli scher Regierungspolitik nicht unterscheiden, ja man müsse leider im Gegenteil davon sprechen, dass die Ausweitung der Siedlungen ein „kriminelles Unternehmen ist, das der israelische Staat betreibt“.
Israelische Moderne
Mo‘ayyad Bisharat ist studierter Veterinär. Als Programmdirektor der palästinensischen Bauernorganisation Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ist der gertenschlanke Mittvierziger allerdings nicht mit Schafen oder Ziegen beschäftigt, sondern mit der Frage, wie palästinensische Bäuerinnen und Bauern dem ständigen Verdrängungsdruck durch die jüdischen Siedler:innen standhalten können. Mit Mo‘ayyad fahren wir in das Dorf Bardala. Es liegt im Jordantal, der Grenzregion zu Jordanien, nicht weit entfernt von der Allon-Straße, die uns Yehuda gezeigt hat. Sie ist hier eine Art zivile Grenzbefestigung gegen den jordanischen Nachbarstaat und damit eigentlich die Grenze eines Großisraels bis an den Jordanfluss. In Oslo wurde diese Region als C-Gebiet deklariert, also als ein Territorium, das innerhalb von fünf Jahren aus der israelischen in die palästinensische Kontrolle übergehen sollte. Bis heute stehen die C-Gebiete jedoch unter vollständiger israelischer Kontrolle.
Unter sengender Sonne fahren wir nach Bardala hinein. Schon von den Anhöhen der letzten Hügel aus können wir die Siedlungen im Tal erkennen, die gleich nach 1967 hier angelegt wurden. Die perfekte israelische Moderne: Riesige Felder, Gewächshäuser und Dattelplantagen, weit das Auge reicht. Diese Siedlungen setzten jedoch nicht darauf, die Zahl der jüdischen Bewohner:innen in der Westbank zu steigern, sondern auf landwirtschaftliche Industrialisierung. Die lokale palästinensische Bevölkerung war und ist als billige Arbeitskraft eingeplant.
Im Dorf Bardala, umzingelt vom israelischen agro-industriellen Komplex, betreiben wenige Hundert palästinensische Bäuerinnen und Bauern den Anbau von Gemüse und Oliven. Wir treffen den Bürgermeister, der neben einer Feuerwache residiert. Er erklärt uns gleich, dass das Feuerwehrauto angeschafft werden musste, weil radikale Siedler immer wieder palästinensische Felder oder landwirtschaftlich genutzte Gebäude in Brand setzten. In Bardala haben die Landwirte keinen Zugang zu Wasser. Als die großen Agroindustrien entstanden, übernahm Israel die Kontrolle. Am Anfang teilte man den palästinensischen Bäuerinnen und Bauern noch Wasser zu. Dann erfand man immer neue Begründungen, die Zuteilungen zu kürzen, bis sie schließlich ganz eingestellt wurden.
Wir fahren mit dem Bürgermeister zu einem Wasserreservoir, das die Bauernorganisation UAWC angelegt hat. Mitten in Dattelplantagen wird es aus den Bergen mit Wasser versorgt, das unter palästinensischer Kontrolle steht. Siedlerdruck und künstliche Wasserverknappung sind nicht das einzige Problem der Bäuerinnen und Bauern. Wer keine Landtitel aus der Zeit des osmanischen Reichs oder der jordanischen Verwaltung nachweisen kann, muss den Verlust des Landes fürchten. „Aber wir leben hier seit Generationen und fühlen uns hier zu Hause. Wir schlafen nicht wie viele Siedler mit einer Waffe unterm Kopfkissen.“ Der Satz des Bürgermeisters von Bardala klingt noch lange bei uns nach. Er beschreibt das fundamentale Problem der israelischen Sicherheitsparanoia. Dieses selbstverständliche Dahin-Gehören eines palästinensischen Landwirts kann durch keine pathetische oder religiöse Begründung erschüttert werden.
Keine Demokratie mit Besatzung
Seit Monaten demonstrieren Israelis zu Hunderttausenden jeden Samstag in Tel Aviv und anderen Städten. Die Demonstrationen richten sich gegen die seit Ende Dezember herrschende ultrarechte Regierung unter Benjamin Netanjahu. Besondere Empörung ruft der Plan der Regierung hervor, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes mit einer einfachen Parlamentsmehrheit zu widerrufen und damit die Gewaltenteilung außer Kraft zu setzen. Im Grunde aber ist es ein Aufstand der säkularen Mittelschicht gegen nationalreligiöse und ultraorthodoxe Regierungsmitglieder, die sich nicht nur kräftig für die eigene Klientel am Haushalt bedienen, sondern neben der Entdemokratisierung Israels auch seine Entsäkularisierung betreiben. Welches Israel es zukünftig geben wird: Das ist die große Frage. Und die vor allem aus Europa stammende liberale Mittelschicht fürchtet um nichts weniger als ihre Lebensweise. Manche transferieren bereits Vermögen ins Ausland. Die vielen Fahnen, die eine als Deutsche seltsam berühren, stehen also wirklich dafür, dass es für viele ums Ganze, um ihr Verhältnis zum Staat geht.

Auf einer Samstagsdemo im Mai in Tel Aviv treffen wir sofort einen alten Bekannten, den Menschenrechtsanwalt Michael Sfard. Er schwirrt im Anti-Besatzungs-Block herum. Nicht viele haben sich hier versammelt. Ihre Losung lautet: Es gibt keine Demokratie mit Besatzung. Demonstrant:innen ziehen mit ihren Israel-Fahnen vorbei. Manche bleiben stehen und hören sich kurz die Reden an, gehen dann weiter. Auf die Frage, was sie von der Losung halten, sagen zwei junge Männer, die aus der Schlafstadt Ramat Gan angereist sind, dass es bei den Protesten nicht um die Besatzung gehe. Der Block dürfe dabei sein, sei aber vollkommen bedeutungslos. Jemand reicht ein Flugblatt, auf dem nur ein Satz steht: Demokratie ist mehr als Politik. Ja, genau so sei es, sagen die beiden jungen Männer, für die Politik nur ein schmutziges Geschäft ist. Einige Sätze später sagt einer der jungen Männer, was das für ihn heißt: „Ich stehe nicht hinter der Regierung. Ich stehe hinter unserer Armee.“
Ein paar Tage zuvor in Haifa hatten wir ein Gespräch mit Ari Remez, Pressesprecher von Adalah, einer Organisation, die Palästinenser:innen in Israel seit 20 Jahren Rechtsbeistand leistet. Remez ist besorgt. Das alles könne in einer großen Katastrophe enden. Die Ultrarechten seien auf diese Regierung sehr gut vorbereitet. Ein rechtsradikaler Thinktank aus 150 Anwält:innen habe Gesetzesvorhaben in der Pipeline, die eine „Einkaufsliste des Horrors“ seien: Sie planten eine „durch und durch rassistische Gesetzgebung“. Die jüdische Überlegenheit (supremacy) solle gesetzlich durchgesetzt werden, verbunden mit vollständiger ökonomischer Deregulierung. Diese Regierung bewege sich schnurstracks auf einen „Point of no Return“ zu. Das Gegenprogramm von Remez hat bislang keine Mehrheit: „Bill of Rights“ lautet sein Vorschlag, das allen unabhängig von der Herkunft ein Recht auf Rechte garantiert. Es fehle jedoch an Solidarität: „Die Demonstranten kämpfen nur für sich selbst.“
P.S.: Bevor ich bei medico anfing, war ich bereits mehrmals in Israel. Da ich aus einer Familie stamme, die während der NS-Zeit rassistisch und politisch verfolgt wurde, war Israel eine Entdeckung für mich. Als ich mitten in der hoffnungsvollen Atmosphäre des Oslo-Friedensprozesses zum ersten Mal dorthin reiste, war es überwältigend für mich, sich in einer Gesellschaft zu bewegen, in der es keine Nazis gab. Ganz anders als in meiner Kindheit in Deutschland, in der es von ihnen nur so wimmelte. Israel hatte für mich etwas Befreiendes. Es war nach der Shoah für Hunderttausende, für die es keinen Ort gab, ein nationales Befreiungsprojekt, das sich nicht auf seine kolonialen Vorzeichen reduzieren lässt. Es hat wie andere Befreiungsprojekte seine ursprünglichen Ziele verfehlt. Das macht diese aber nicht obsolet.
Sie können die Arbeit der medico-Partnerorganisationen in Israel und Palästina mit einer Spende unterstützen.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 2/2023. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!