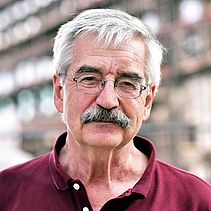1.
In den zurückliegenden Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen für Hilfe zum Teil dramatisch verändert. Sowohl in ihrer Zahl als auch in ihrer Intensität haben Katastrophen und Krisen zugenommen. Inzwischen ist von sogenannten protrahierten Krisen die Rede, deren Wirkungen mitunter erst verzögert, dann aber in der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg auftreten. Herkömmliches entwicklungspolitisches Handeln wird unter diesen Umständen zunehmend in Frage gestellt.
2.
Zu den Naturkatastrophen, wie Erdbeben oder Überschwemmungen, ist eine Vielzahl von „man-made“ Desastern hinzugekommen, die ihre Ursachen im Klimawandel, in zunehmender sozialer Ungleichheit, in Staatsauflösung und/oder Kriegen finden. Nicht selten sind es multiple Krisen, die sich vor diesem Hintergrund herausbilden.
Exemplarisch verdeutlicht der Ausbruch von Ebola, wie sich eine einzelne Krise zu einem multiplen Krisengeschehen aufschaukeln kann, das schließlich alle gesellschaftlichen Sphären tangiert: den Bildungssektor, die Ernährungssicherheit, die Wirtschaftskraft, das Sozialgefüge. Solche vielfachen Krisendynamiken treten heute vermehrt auf.
Nicht zuletzt die millionenfache Flucht und Migration von Menschen ist Ausdruck und Folge eines sich immer mehr verfestigenden multiplen Krisengeschehens.
3.
Mit der Globalisierung ist die Welt fraglos näher zusammengerückt, doch zeigt sie sich heute gespaltener denn je. Dem globalen Norden mit seiner wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Vorherrschaft stehen heute wachsende Zonen des Elends, der Demütigung und Gewalt gegenüber: der globale Süden. Und der hat sich längst auch in den Vorstädten Nordamerikas und Europas ausgebreitet.
Es sind zwei gegenläufigen Bewegungen, die die bisherige Globalisierung bestimmt haben: einerseits ist die Welt zu einem globalen System integriert worden, wodurch erstmals die Möglichkeit weltgesellschaftlicher Verhältnisse aufscheint. Andererseits wurden große Teile der Weltbevölkerung, für die es in eben diesem System keinen Platz zu geben scheint, sozial ausgegrenzt. Sie wurden zu „Redundant People“, wie es im Englischen heißt: zu Menschen, die in den weltwirtschaftlichen Zusammenhängen nicht mehr gebraucht werden, die „überflüssig“ sind. Viele von ihnen überleben in einer auf Dauer gestellten Lagerexistenz.
4.
Dieser dramatische Zuwachs von Ungleichheit ist kein Betriebsunfall, sondern unmittelbare Folge der marktradikalen Umgestaltung der Welt sowie der Schrumpfung der Arbeitsmärkte durch Einführung neuer Technologien. Das Versprechen, dass dabei auch etwas für die Armen abfallen würde, hat sich als Trugschluss erwiesen. Statt zu einem Trickle-down-Effekt kam es zu dessen Gegenteil, zur Umverteilung von unten nach oben. Die Reichen wurden reicher, die Armen ärmer. Acht Einzelpersonen, so Oxfam, sollen heute so viel besitzen wie die unteren 3,5 Mrd. der Weltbevölkerung zusammen.
„Weltgesellschaftlich gesehen ist das Megathema der nächsten 30 Jahre nicht mehr Ökologie und nicht mehr nachhaltige Entwicklung, sondern Ungleichheit“, schrieb kürzlich der deutsche Sozialwissenschaftler Heinz Bude in einer Studie der Bertelmann-Stiftung. Selbst das Davoser Weltwirtschaftsforum musste Anfang des Jahres eingestehen, dass sich im Zuge der Globalisierung das Risiko für soziale Verunsicherung drastisch vergrößert habe.
5.
Der im Herbst 2015 veröffentlichte Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland lässt keinen Zweifel: das Elend der Welt hat längst ein Ausmaß angenommen, das durch Hilfe nicht mehr gemildert werden kann. Auf dramatische Weise übersteigt heute der Bedarf an Hilfe die weltweit zur Verfügung stehenden Mittel. Selbst die großen UN-Hilfswerke sind inzwischen überfordert. Die ungebremste Krisendynamik der letzten Jahre hat das internationale humanitäre System gesprengt. „Wir stehen an einem Wendepunkt in der Geschichte“, so kürzlich Stephan O’Brien, der UN-Nothilfekoordinator mit Blick die Hungerkatastrophe in Ost-Afrika und Jemen, die bis zu 20 Mio. Menschen bedroht.
6.
Und so nimmt es nicht Wunder, dass die internationale humanitäre Hilfe derzeit einen Paradigmenwechsel vollzieht: Über eine Reaktion auf plötzlich eintretende Katastrophen und Krisen hinausgehend werden Instrumente der humanitären Hilfe zunehmend vorausschauend geplant und eingesetzt. Verantwortungsbewusste humanitäre Hilfe entfaltet nicht nur reaktive, sondern auch gestaltende Wirkung. Risikoanalyse und Risikomanagement sind ebenso gefordert wie die Bereitstellung von Hilfen im Falle akuten Bedarfs. Unmittelbare Nothilfe kann nur als ein Baustein von humanitärer Hilfe benannt werden. Vorausschauende strategische Hilfe muss über unmittelbare Nothilfe hinaus weitere Dimensionen betrachten, zu denen die strukturelle Prävention von Krisen, die systematische Förderung von lokalen Vorbeugungs- und Bewältigungskompetenzen und die Stärkung öffentlicher und sozialpolitischer Institutionen gehören.
7.
Als zweischneidig erweisen sich dabei die Resilienz-Konzepte. So vernünftig es ist, Menschen bereits im Vorfeld von Katastrophen beim Aufbau eigener Bewältigungskapazitäten zur Seite zu stehen, so problematisch wird es, wenn das Bemühen um Resilienz zur Rechtfertigung dafür herhalten muss, nichts mehr gegen die Ursachen von Krisen, namentlich die strukturelle Gewalt und den anhaltenden sozialökologischen Zerstörungsprozess tun zu müssen.
Dazu der Trendforscher Matthias Horx, einer der Stichwortgeber der neoliberalen Umgestaltung der Verhältnisse: „Resilienz wird in den nächsten Jahren den schönen Begriff der Nachhaltigkeit ablösen. Hinter der Nachhaltigkeit steckt eine alte Harmonie-Illusion, doch lebendige, evolutionäre Systeme bewegen sich immer an den Grenzlinien des Chaos.“ Was Horx als „Harmonie-Illusion“ verunglimpft, ist die normative Dimension, die in der Idee der Nachhaltigkeit steckt. Sie impliziert Wertvorstellungen, an denen sich politische, ökonomische und technologische Entscheidungen auszurichten haben. Ein solches normatives Konzept fehlt der Idee der Resilienz: Ihr geht es nicht mehr um gesellschaftliche Ideale, sondern nur um die Frage, wie sich Menschen und Systeme gegen Störungen – gegen eine aus den Fugen geratenen Welt schützen: sprich: wie sie sich fit für die Katastrophe machen können.
8.
Wo Menschen dauerhaft krisenhaften Lebensumständen ausgesetzt sind, verändert sich auch der Bedarf an Hilfe. Deutlich wird das z.B. in der medizinischen Hilfe. Weil vermehrt auch Menschen mit mittlerem Lebensstandard von Krisen betroffen sind, muss sich Hilfe nicht nur auf die Behandlung akuter Infektionskrankheiten, sondern auch auf chronische, nicht übertragbare Krankheiten, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. einstellen.
9.
Vor allem im Kontext bewaffneter Konflikte gestaltet sich heute Hilfe sehr viel komplizierter. Zum einen wächst der Prozentsatz intern Vertriebener (im Verhältnis zu denen, die außer Landes fliehen), die in aller Regel schwerer zu erreichen sind (s. Syrien). Zum anderen nehmen die Sicherheitsrisiken für die Helfer zu. Vermehrt werden heute humanitäre Einrichtungen zu Ziel von militärischen Angriffen. Dort, wo Konfliktparteien auch vor terroristischen Aktivitäten nicht zurückschrecken, wird eine angemessene humanitäre Hilfe mehr und mehr unmöglich. In solchen Kontexten kann die Versorgung notleidender Menschen nur unter hohem Risiko für die Helfer und oft nur punktuell und sehr flexibel organisiert werden.
10.
Wo sich krisenhafte Lebensumstände verfestigen, verlieren lokale Machthaber den Rückhalt in der Bevölkerung. Um den daraus resultierenden Legitimationsdefiziten zu entgehen, versuchen viele Regierungen, die Handlungsspielräume von unabhängigen und kritischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die auf Accountability drängen, einzuschränken (Shrinking Spaces). Die Maßnahmen reichen von restriktiven NGO- und Mediengesetzen und bürokratischen Auflagen über Hetzkampagnen und Zensur bis hin zu offener Repression durch Sicherheitskräfte. Betroffen sind sowohl die Partner vor Ort, als auch deren internationale Unterstützer.
11.
Es reicht nicht mehr, Hilfe nur verschieden zu interpretieren, es kommt darauf an, sie zu überwinden.