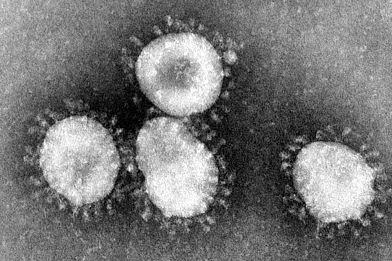Das aktuelle Schlagwort zur Coronavirus-Pandemie ist Solidarität: Alle sind gefährdet, deshalb müssen alle zusammenstehen und sich und die anderen schützen, und ganz besonders die Gefährdeten und Schwachen, die Alten und Kranken. Aber stimmt das wirklich? Ein genauerer Blick zeigt, dass die existierenden Ungerechtigkeiten in der Krise eher noch weiter verschärft werden. Das beginnt hier in Deutschland und Europa: Während Heimarbeitsregeln und Kurzarbeitsgeld für Festangestellte und günstige Überbrückungskredite für Unternehmen rasch zur Verfügung stehen, sieht es für die große Zahl der selbständig Prekären ganz anders aus. Nicht nur die vielen Kulturschaffenden, deren Veranstaltungen abgesagt werden müssen, auch der Messebauer, die selbständige Seminar-Moderatorin, die stunden- und kursweise bezahlten Trainer*innen im Fitnesstudio verlieren, nachdem die große soziale Distanzierung ausgerufen worden ist, in den kommenden Wochen und vielleicht Monaten einen großen Teil ihrer geplanten Einnahmen. Und welche Option des Rückzugs in die eigene Wohnung haben Obdachlose und Geflüchtete in Massenunterkünften oder gar in überfüllten Camps an Europas Außengrenzen?
Und noch einmal verschärft sich die Kluft in den Ländern des Südens, in denen das Virus in Einzelfällen schon angekommen ist: Eine massive Einschränkung des öffentlichen Lebens wird für die vielen Millionen von Kleinhändler*innen auf den Straßen der Millionenstädte in Afrika oder Lateinamerika oder Asien zu einer sofortigen existentiellen ökonomischen Bedrohung. Ausgangssperren und Grenzschließungen zwischen den Ländern behindern den grenzüberschreitenden Handel massiv, wie schon angesichts der Ebola-Epidemie in Westafrika 2014/15 zu sehen war. Anders als in Europa gibt es in diesen Weltregionen allerdings keine Ausgleichsmechanismen, wie sie aktuell die EU-Kommission vorschlägt. Hier können drastische „physical distancing“ Maßnahmen enormen Schaden für Einzelne und ganze Gemeinschaften anrichten. Diese dürfen nicht als leider notwendige „Kollateralschäden“ kleingeredet werden, sondern sind in den Konzepten zur Unterstützung dieser Länder ebenso wichtig wie direkte Hilfen zur Gesundheitsversorgung an Covid-19 erkrankter Menschen. Auch bestehende Konflikte zwischen ansässigen Gemeinden und Flüchtlingslagern können weiter eskalieren. Darauf deutet es zum Beispiel hin, wenn, wie es aus dem Libanon mit über einer Million syrischer Schutzsuchender berichtet wird, die Geflüchteten zu Trägern der neuen gesundheitlichen Bedrohung erklärt werden; oder wenn Präventionsprogramme selektiv nur der einen oder der anderen Gruppe zugute kommen, je nachdem ob humanitäre Hilfsprogramme oder staatliche Unterstützungen verfügbar sind.
Und auch bei der jetzt einsetzenden Priorisierung von Kapazitäten des Gesundheitssystems hin zu Fallsuche, Quarantäneüberwachung und Versorgung von an Covid-19 Erkrankten gilt es im Blick zu behalten, dass die oft überstrapazierten Gesundheitsarbeiter*innen ihre bisherigen Patient*innen nicht einfach hintenanstellen können, ohne deren Versorgung und Gesundheit zu gefährden. Dies wird auch in deutschen Krankenhäusern diskutiert werden, wenn die Fallzahlen weiter steigen. Vor dem Hintergrund multipler Gesundheitskrisen etwa in informellen Siedlungen in Südafrika mit Tuberkulose, HIV/Aids und Gewaltopfern hat es gleichwohl eine ungleich dramatischere Ausprägung. Denn ein massiv unterbesetztes und unterfinanziertes öffent- liches Gesundheitssystem stellt für den größten Teil der Bevölkerung die einzige Option der Gesundheitsversorgung dar.
Hier nähern sich die Erfahrungen und Stimmen aus den aktuellen europäischen Krisengebieten in Italien oder Spanien in erstaunlicher Weise denjenigen aus dem globalen Süden an. In einem offenen Brief fordert das überlastete Klinikpersonal aus Bergamo eine Wende von einer einzelfallbezogenen und klinikzentrierten Versorgung der Patient*innen zu einem gemeindeorientierten Konzept mit einer qualifizierten häuslichen Versorgung, weil die Krankenhäuser selbst zu überlasteten Orten der Infektionsverbreitung geworden sind. Diese Forderung nimmt – vermutlich ohne es zu wissen – die Erfahrungen der Community Health Worker in Südafrika auf, die der entscheidende Faktor in der Versorgung chronisch Kranker in einem ausgebluteten öffentlichen Gesundheitssystem geworden sind.
Mit solchen Konzepten außerhalb institutionalisierter Denkweisen werden auch die Aktivitäten des Gesundheitspersonals jenseits der oft miserabel bezahlten „Dienstleistung“ sichtbar. Sie sind zugleich Interessenvertreter*innen der Kranken und fordern Rechenschaft von den Institutionen ein, sowohl in Italien wie in Südafrika, um das international verankerte Recht auf Gesundheit tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Genauso können diese Gesundheitsaktivist*innen in der aktuellen Lage eine kritische Begleitung der öffentlichen Maßnahmen sein, die jetzt in immer mehr Ländern die Bewegungsfreiheit einschränken. Ein beeindruckendes Beispiel bietet auch hier wieder die südafrikanische Zivilgesellschaft, die in einem „Program of Action in the time of Covid-19. A Call for social solidarity“ aktuell die konkreten Unterstützungsmaßnahmen für Menschen auflistet, die sich nicht in Eigenheime und Homeoffice zurückziehen können.
Solche Verbindungen, die der „räumlichen Trennung“ eine „soziale Solidarität“ an die Seite stellen, finden sich an vielen Orten der Welt. Sie könnten auch eine längerfristige Perspektive bilden, die die herrschende Konkurrenz von Weltmarkt und nationalen Egoismen grundlegend und erfolgreicher in Frage stellen als es vor der aktuellen Pandemie möglich war.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 1/2020. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!