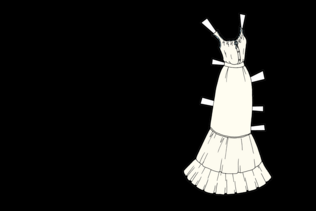1. Die Ukraine
Als 1995 im Rowohlt-Verlag das Buch des sowjetisch-jüdischen Schriftstellers Friedrich Gorenstein „Reisegefährten“ erschien, erweckte der Roman nicht viel Aufmerksamkeit. Dabei nahm das Buch die Idee der multidirektionalen Erinnerung vorweg. Die Idee also, dass historische Tragödien und Menschheitsverbrechen nicht nur vergleichbar sind, sondern sich womöglich in einer Unerträglichkeit und Parallelität ereignen, die in ihrer Unerträglichkeit das emotionale Verarbeitungsvermögen der Einzelnen übersteigen. Man hätte auch damals schon sehr viel über die historische Erfahrung des Sowjetmenschen und des ukrainischen insbesondere lernen können. Wir wären so viel besser auf die heutige Situation, den Angriffskrieg des russischen Regimes auf die Ukraine und den bewegenden Widerstand der Menschen, die nun durch den Krieg endgültig zur ukrainischen Republik zusammengefunden haben, vorbereitet gewesen.
Gorenstein gehörte zur Generation der sowjetisch geprägten jüdischen Intelligenzija, der noch vor 1990 den postsowjetischen Raum verließ, weil er schon zu viel erlebt hatte, was ein Mensch nicht aushalten kann: Deportation und früher gewaltsamer Tod des Vaters, Schreibverbote und Zensur. Antisemitismus und Stalinismus waren die Lebensthemen des Schriftstellers. In seinem Berliner Exil verfasste er die „Reisegefährten“, einen Roman zweier Menschen, die sich während einer Bahnfahrt durch die ukrainische Landschaft aus langen Ebenen und Birkenwäldern entlang der eigenen Biografie die Geschichte der Judenvernichtung durch die Deutschen und den von Stalin erzwungenen Hungertod von Millionen Ukrainer:innen erzählen. In der Einsamkeit der Reisenden, in der Abgeschiedenheit eines Abteils, im nicht endenden Rhythmus der Eisenbahn.
Die meisten Ukrainer:innen, egal welcher sprachlichen Herkünfte, pochen heute darauf, dass die uneingelösten Versprechen der Geschichte nun zum Tragen kommen müssen. Nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl retteten Hunderttausende „Liquidatoren“ Europa vor einer noch viel größeren Nuklearkatastrophe. Die ersten Hundert kamen aus Kiew und warfen mit bloßen Händen Sand in das brennende Atomkraftwerk. Seriöse Schätzungen gehen von bis zu 50.000 toten Männern aus, die die AKW-Katastrophe zu bändigen suchten, ganz abgesehen von einer dezimierten Generation damals junger Menschen in der Nähe des AKWs und vieler weiterer ziviler Opfer.
Drei große Aufstände gab es seit 1990 in der Ukraine, die eine Demokratisierung und Entoligarchisierung ihrer Institutionen zum Ziel hatten. Sie konnten Regierungen ab-, aber keine Transformation durchsetzen. Die Ukraine ist das Armenhaus Europas. Das zeigt sich im Zugriff auf ukrainische Arbeitskräfte, die auf dem zweiten illegalen Arbeitsmarkt am heftigsten ausgebeutet werden. Der ukrainische Soziologe Wolodymir Ischtschenko spricht von der Ukraine als „nördlichstes Land des Globalen Südens“. Dass die Ukrainer:innen sich nicht ergeben und einem „Torpedokäfer“ gleich gegen den reinen Pragmatismus des Möglichen anrennen, erklärt sich aus der Geschichte.
2. Unser Entsetzen
Das Erschrecken darüber, dass sich kaum jemand diesen Putin-Angriff trotz der präzisen US-amerikanischen Vorhersagen vorstellen konnte, hat hierzulande eine eitle Debatte um die Frage, wer das schon immer wusste, ausgelöst. Dramatischer ist, dass diese Unberechenbarkeit zwar in der Welt, aber nicht in unseren Gedanken war. Jetzt aber greifen tiefe Ängste und Unsicherheiten darüber um sich, was noch an bisher nicht Vorstellbarem kommen mag. Die putinsche Kriegsführung hat das genau bedacht und deshalb offen mit dem Atomschlag gedroht. Während sich Menschen in Polen, den baltischen Staaten und den anderen Ländern, die nicht freiwillig zum sowjetischen Hinterhof gehörten, im Alptraum der Wiederauferstehung einer postsowjetischen Vorherrschaft und Diktatur wiederfinden, erleben die westeuropäischen Bevölkerungen den Kalten Krieg mit seiner steten atomaren Bedrohung noch einmal.
Wer zu Hause Eltern sitzen hat, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebten, und dann die Nachricht bekommt, dass der KZ-Überlebende Boris Romantschenko bei einem russischen Bombenangriff auf Charkiw ums Leben gekommen ist, für den ist die Welt so wenig in geopolitischer Ordnung wie die eigenen Gefühle. Wenn wir bei der Covid-Pandemie die Hoffnung haben, dass sie irgendwann ausgestanden sein wird, so hat der Krieg gegen die Ukraine jede Idee von einer Rückkehr zu unserem alten Leben zunichtegemacht. Dass es ein behagliches Leben auf Kosten anderer Weltteile war, wussten wir. Nun haben der Krieg vor unserer Haustür und die Millionen Flüchtlinge, die wahrscheinlich so schnell keine Aussicht auf Rückkehr haben, endgültig mit der Illusion des Weiter-so Schluss gemacht.
3. Der Krieg ist schon lange in der Welt
Es kann dabei nicht trösten, dass die Unberechenbarkeit längst in anderen Teilen der Welt alltägliche Erfahrung ist. Der Krieg ist schon lange in einer Welt, die sich als das Ende der Geschichte begreift, auch in Europa. Der erste europäische Krieg nach 1990, der die Idee von einer friedlichen Transformation des Ost-West-Konflikts bereits Lügen strafte, kann uns Lehren für die heutige Situation aufzeigen.
Der Journalist Norbert Mappes-Niediek machte kürzlich in einem Beitrag im Angesicht des ukrainischen Krieges auf die damaligen Debatten um eine Flugverbotszone aufmerksam. Sie wurde damals wie heute gefordert und letztlich in Bosnien auch eingerichtet. Damals, so Mappes-Niediek, spielten Luftangriffe militärisch keine große Rolle. Die Flugverbotszone bewirkte vielmehr den Einstieg in eine Militärintervention. Insofern ist die Debatte, der wir heute in den Medien mit einem hohen moralischen Ton ausgesetzt sind, viel folgenreicher, als sie mit ihren humanitären Argumenten erscheint. Mappes-Niediek schlussfolgert aus seiner Betrachtung der jugoslawischen Erfahrung: Wer die Weltkatastrophe verhindern wolle, müsse manchmal auch den Mut haben, zu Forderungen der angegriffenen Partei Nein zu sagen.
4. Die Sanktionen
Jenseits eines Einstiegs in den Krieg mit seinen unabwägbaren Folgen gibt es andere Mittel, diesen gewalttätigen Überfall des russischen Regimes zu sanktionieren. Die Wahl dieser Mittel aber sollte sich der Gut-Böse-Dichotomie enthalten. Alle tragen, so scheint es, bereits eine Uniform: Die des Freiheitskämpfers, des Stalinisten oder des liberalen Demokraten. Die Weltunordnung findet aber gerade nicht im Kampf der Systeme statt. Sie ist ein Ergebnis vom Ende der Politik, von der Herrschaft der Ökonomie – und das alles im Zeichen der Klimakatastrophe. Schon vor Jahren haben wir in einem Rundschreiben geschrieben: Der Desasterkapitalismus kommt nach Hause zurück. Jetzt ist er wirklich zurück. Sowohl in seiner autoritären als auch in seiner liberalen Ausformung ist er Teil des Problems und nicht der Lösung.
„Die Konfrontation zwischen ‚Demokratien‘ und ‚Autokratien‘ wird überzeichnet und dabei vergessen, dass die westlichen Länder mit Russland und China nicht nur eine ungezügelte hyperkapitalistische Ideologie teilen, sondern auch ein rechtliches, steuerliches und politisches System, das große Vermögen immer mehr begünstigt“, schreibt der französische Ökonom Thomas Piketty. Er fordert Sanktionen, die gegen die Oligarchen zielen und nicht gegen die russische Bevölkerung. Den Gedanken der Tobin-Steuer wieder aufzugreifen und auszuweiten wäre eine gute Idee, um in diesem Krieg die Weltunordnung anzugreifen.
Putin bekundete 1993 bereits seine Sympathie für das Pinochet-Modell in Chile. Diese Sympathie für eine diktatorische Idee ist älter als die eurasische Ideologie, die eine geistig arme Herrschaft verdeckt, die ein Z an die Tür malt und alle frei Denkenden zwingt, das Land zu verlassen. Der Feldzug gegen die Ukraine ist vor allen Dingen ein Mittel, diese Herrschaftsform zu sichern. Vielleicht ist das der eigentliche Zweck des Krieges.
5. Solidarische Hilfe oder: weitermachen
Es gibt eine überwältigende Solidarität mit den Ukrainer:innen und den aus der Ukraine Flüchtenden. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft sind ein Anfang. Sie begründen wie schon 2015 eine Willkommenskultur gegen die Angst vor dem Anderen und für eine Gesellschaft mit vielen Herkünften. Es liegt darin die Chance, eine solidarische Assoziation jenseits des Nationalstaates mit seinen Ausschlüssen und Abgrenzungen zu schaffen. Wenn sich das europäische Haus nun von unten aufbaut, in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen historischen Erfahrungen und Narrativen, dem gegenseitigen Nichtverstehen und doch Beisammenstehen, dann öffnet sich eine neue Tür.
Viele Fragen sind unbeantwortet: Wie setzen wir die Dekolonisierung Europas fort und begreifen die ost- und ostmitteleuropäische Erfahrung als Teil dieses Prozesses? Wie gelingt es, den Multilateralismus neu zu fassen und die globalen Institutionen jenseits des Nationalstaates zu wirkmächtigen weltdemokratischen Aushandlungsorten zu machen? Wie verankert sich das Recht auf Rechte, das jedem und jeder zusteht – auch den Flüchtlingen –, in Gesetzen, die noch der Nationalstaat macht, die aber bereits über ihn hinausweisen? Diese Fragen sind keine Antwort auf den Krieg. Wenn aber die Weltunordnung offenkundig gekennzeichnet ist von größter Unberechenbarkeit, dann lässt sich nur da weitermachen, wo Menschen am universellen und für alle gleichen Recht arbeiten, das Gemeinwohl neu erfinden und sich nicht uniformieren lassen.
Dieser Beitrag eröffnet den Ukraine-Schwerpunkt im neuen medico-Rundschreiben, das Anfang April erscheint. Darin unter anderem Beiträge von Sandro Mezzadra, Eva von Redecker, Yassin al-Haj Saleh und eine Reportage aus der Grenzregion.