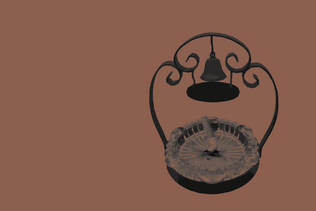Tareq Alaows ist flüchtlingspolitischer Sprecher der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Alaows kam im Sommer 2015 aus Syrien nach Deutschland und war als Aktivist an zahlreichen Bewegungen und Kampagnen beteiligt. Außerdem kandidierte er für Bündnis 90/Die Grünen bei der Wahl 2021 als erster syrischer Geflüchteter für den deutschen Bundestag, zog seine Kandidatur aber aufgrund von Anfeindungen und Drohungen zurück.
Du bist im Sommer 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Viele Menschen hat es damals zufällig an bestimmte Orte Europas verschlagen. Wie war es bei dir?
Ich hatte keine besondere Beziehung zu Deutschland. Ich habe Syrien verlassen, weil ich verfolgt wurde – allerdings nicht nur vom Regime, sondern auch von islamistischen Gruppen, wie übrigens viele andere in jener Zeit. Ich wollte nur weg. Ich ging in die Türkei und entschied schnell, über die Balkanroute weiterzuziehen. Mich besorgten die Präsenz der Islamisten in der Türkei und die geografische Nähe zum syrischen Regime. Das schürte alte Ängste. Schon in Syrien hatte ich humanitäre Arbeit geleistet, deshalb fiel mir immer wieder die Verantwortung für große Gruppen zu. Da ging es teilweise um Leben und Tod, zum Beispiel auf der Bootsfahrt von der Türkei nach Griechenland.
Wie ging es dann für dich weiter?
Ich hatte kein Ziel, so wie die meisten anderen, die ich unterwegs traf. Wir liefen einfach weiter, wie es gerade ging, quer durch Europa. Irgendwann kamen wir in Wien am Bahnhof an, was mir bis heute besonders in Erinnerung geblieben ist. Zum ersten Mal sagte jemand zu uns „willkommen“. Ich war zuvor in Ungarn und habe dort die Massenproteste vor dem Bahnhof Keleti erlebt, wo einige Tage später der legendäre „March of Hope“ über die Autobahn Richtung österreichischer Grenze aufbrach. Das Ausmaß der Polizeibrutalität in Ungarn war unglaublich. Sie haben uns behandelt, als könnten sie mit Gewalt unsere Existenz ungeschehen machen. In Wien habe ich dann ein Zugticket nach Dortmund bekommen. Ich hatte keine Ahnung, wo Dortmund liegt, geschweige denn, was mich erwarten würde. Als ich dort mitten in der Nacht ankam, fühlte ich mich todmüde. Und ich hatte zum ersten Mal Hunger, nach 45 Tagen, die ich von Syrien bis nach Deutschland unterwegs war. Weil sonst nichts geöffnet hatte, bin ich zu McDonalds gegangen. Nach dem Essen habe ich eine geraucht und verspürte ein schon fast vergessenes Gefühl von Sicherheit. Da habe ich entschieden, dass ich in Dortmund bleiben werde. Ich bin zur Erstaufnahmeeinrichtung und habe mich registrieren lassen.
In Syrien gab es nicht erst seit der Revolution keine Sicherheit für Oppositionelle. Doch vieles verschärfte sich nach 2011. Du warst damals dabei. Wie hast du das erlebt?
Ich bin in einer politischen Familie aufgewachsen. Mein Vater war Journalist. Zu Hause wurde bei uns über alles gesprochen. Allerdings galt aus Angst um uns ein striktes Verbot, außerhalb der eigenen vier Wände über Politik zu reden. 2003 gab es ein für mich einschneidendes Erlebnis: Mein Cousin, der ebenfalls Journalist war und für eine oppositionelle ausländische Zeitung schrieb, wurde festgenommen. Mein Vater wurde als Verwandter ebenfalls sanktioniert. Er wurde vom Dienst suspendiert und hatte Schreibverbot. Nach drei Jahren wurde mein Cousin dann freigelassen – aus Sednaya. Ich hörte von ihm die furchtbaren Geschichten, die sich dort ereigneten. Alle Vorwürfe gegen ihn wurden fallengelassen, das Schreibverbot aber blieb bestehen. Er war seitdem arbeitslos. Diese Mischung aus ungemeiner Brutalität und perfider Schikane empfand ich als besonders schrecklich.
2011 ist dann die Wut, die sich auch aus solchen Geschichten speiste, explodiert.
Ich erinnere mich noch, dass mein Vater krank war. Ich fuhr von Aleppo, wo ich damals studierte, nach Damaskus, um ihn zu besuchen. Im Krankenhaus habe ich besagten Cousin getroffen. Es waren jene Tage, in denen in Ägypten Mubarak gestürzt wurde. Ich habe ihn gefragt: „Glaubst du, bei uns wird etwas Ähnliches passieren?“ Er sagte: „Ich hoffe es.“ Als die Revolution dann tatsächlich ausbrach, war ich in Aleppo und habe an Demos an der Uni teilgenommen. Man ging extrem brutal gegen uns vor, nicht nur auf der Straße. Die Polizei kam jede Nacht in unsere Studierendenunterkunft. Damals fotografierten die Geheimdienste die Teilnehmer der Demonstrationen, nachts suchten sie nach ihnen in unseren Betten. Wir wussten, dass diejenigen, die sie holen, nicht zurückkommen würden. Wir riskierten unser Leben. Trotzdem war ich nicht dafür, dass sich die Revolution bewaffnet. Als der Bürgerkrieg 2013 begann, habe ich mich deshalb in der humanitären Hilfe engagiert, beim syrisch-arabischen Roten Halbmond. Dort konnten wir den Menschen trotz vieler Einschränkungen helfen. Wir waren viele Oppositionelle und haben die Plattform auch für klandestine Arbeit genutzt: Menschen wurden versteckt, Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.
Die Öffentlichkeit in Deutschland rätselt bis heute, was 2015 genau geschah. Der Welt-Redakteur Robin Alexander warf der Bundesregierung damals vor, dass sie eine „Getriebene“ der Migrationsbewegung gewesen sei. Welchen Einfluss oder Nachhall hatte die syrische Revolution deiner Meinung nach in diesen Monaten?
Angela Merkel hat im Sommer 2015 den humanen Weg gewählt, als sie vor der Entscheidung stand, die Grenzen zu öffnen oder massive Gewalt einzusetzen und Tote zu riskieren. Aber der Druck war gigantisch: Die Menschen haben die Grenzen geöffnet – nicht die Kanzlerin. Sie hat es geschehen lassen. Ohne die Erfahrungen der syrischen Revolution wäre vieles so nicht passiert. Alte Strukturen wie Facebook-Gruppen wurden zur Organisierung von Fluchtrouten genutzt. Der Informationsfluss war enorm, ebenso die Fähigkeit, die europäische Öffentlichkeit anzusprechen. Es ist viel Grenzgewalt dokumentiert worden und immer wussten alle, die unterwegs waren, Bescheid. Wir bewegten uns auf der Flucht in kleinen Gruppen und haben versucht, uns zu warnen. Es gab also eine Solidarität aller, die unterwegs waren.
Selbst nach dem Sturz des Assad-Regimes ist die Figur des syrischen Flüchtlings in der deutschen Debatte ohne eigene politische Geschichte. Warum?
Die Fluchtbewegung von 2015 war keine politische Bewegung, aber das Geschehene hatte eine politische Dimension. Natürlich ging es um existenzielle Fragen. Eine Bootsfahrt über das Meer in einem Schlauchboot riskierst du nicht aus „politischen Gründen“, sondern nur, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Hätte die internationale Gemeinschaft die Bevölkerung in Syrien gegen die Assad-Diktatur unterstützt, hätte es anders ausgehen können. Es gab also eine internationale Verantwortung für die Fluchtbewegungen. „Wir haben nichts mehr zu verlieren und kämpfen deswegen weiter, bis wir irgendwo sind, wo wir Sicherheit haben.“ Das war kein politisches Programm, aber eine Forderung des Moments.
Du hast gesagt, in Wien hätte man zum ersten Mal „willkommen“ gesagt. Kurze Zeit später nannte man das millionenfache Engagement Willkommensbewegung. War sie das wirklich?
Ja, das war es tatsächlich. Ich habe es genau so erlebt. Es war schön! Ich kam nach der Erstaufnahme in eine Turnhalle in Bochum. Es gab Yoga, Deutschkurse, Sinnvolles und Sinnloses, aus guten und manchmal auch etwas zwiespältigen Motiven. Trotzdem: Alle waren von einer persönlichen Motivation angetrieben, zu helfen. Und die daraus entstandenen ersten Begegnungen waren extrem wichtig. Die Menschen hatten durchaus Ängste, aber sie haben sie über die Begegnung abgebaut. Es ist Vertrauen gewachsen. Viele Menschen von damals wurden Freunde und mit vielen habe ich immer noch Kontakt. Das gilt sogar für meinen damaligen Heimleiter. Er ist bis heute eine wichtige Person in meinem Leben.
Was ist seitdem mit der Willkommensbewegung und ihren Motiven passiert? Wie erklärst du dir den Rechtsruck angesichts der Erfahrungen von damals?
Es ist viel kaputtgegangen. Viele Menschen wollten helfen, doch der Staat und die öffentliche Bürokratie reagierten viel zu langsam und konnten mit den neuen Anforderungen, darunter die Einbindung und Unterstützung der Ehrenamtlichen, nicht umgehen. Noch schwieriger war es, die Geflüchteten als Menschen mit eigener Geschichte anzusehen und nicht als Objekte der Hilfe. Als ich in Bochum lebte, war ich oft bei der Stadtverwaltung und habe meine Expertise aus der humanitären Hilfe in Syrien angeboten. Ich wusste, wie man geflüchtete Menschen unterbringt und Massenunterkünfte organisiert. „Du brauchst selbst Hilfe, wie kannst du helfen?“ Dieser Satz wurde tatsächlich so zu mir gesagt. Selbst viele Jahre später kam von öffentlicher Seite so gut wie nichts. Das war 2022, als die Ukrainer:innen kamen, ähnlich. Viele haben sich irgendwann ermüdet zurückgezogen oder nur noch „private“ Solidarität geleistet, also einzelnen Leuten geholfen, die ihnen ans Herz gewachsen waren. Der deutsche Staat hätte diese große Bereitschaft der Leute aufgreifen und die Willkommenskultur institutionalisieren müssen. Stattdessen hat er mit Asylpaketen reagiert. Man hat migrationspolitisch gehandelt, als hätte es die Willkommensbewegung und die große Solidarität nicht gegeben. Das war eine große Entmutigung.
Wie hat sich diese Entwicklung im Umgang mit Menschen aus Syrien, die hier leben, niedergeschlagen?
Der Tonfall hat sich radikal gewandelt. 2015 bekamen syrische Menschen einen Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz im Schnellverfahren. Sie mussten keine individuellen Verfahren durchlaufen und konnten deshalb sehr schnell die Notunterkünfte verlassen und Familiennachzug beantragen. Sie konnten arbeiten oder zunächst Hartz IV erhalten, eine Wohnung mieten, die Sprache lernen, ein Leben anfangen. Dann wurden die Schnellverfahren gestoppt und man wechselte zu individuellen Verfahren. Das brachte dann, wie in Deutschland üblich, enorme Zeitverzögerung mit sich. Auch ich habe fast zwei Jahre gebraucht, bis ich eine Aufenthaltserlaubnis hatte.
Warum das alles?
Der Umgang mit uns war meiner Meinung nach ein Signal nach außen: Man hat uns hier schikaniert, damit nicht weitere Leute nachkommen. Das sollte sich herumsprechen. Die Leute sollten in der Türkei und im Libanon bleiben. Schnell hat man auch asylpolitisch aufgerüstet: der EU-Türkei-Deal auf europäischer Ebene, in Deutschland dann die Aussetzung von Familiennachzug für zwei Jahre bei allen Menschen mit subsidiärem Schutz. Für viele war das doppelt schlimm, ich habe damals sehr oft den Satz gehört „Ich bin doch für meine Familie nach Deutschland gekommen.“
Du wolltest auch wegen solcher Erfahrung in die Politik.
2016 habe ich „Refugee strike Bochum“ mitgegründet. Wir haben auf kommunaler Ebene versucht, etwas an unserer Situation zu ändern und Streiks organisiert. Früh haben wir allerdings gemerkt, dass die Bundesgesetze entscheidend sind. Dann fing 2018 die Debatte über Seenotrettung an, nachdem das Rettungsschiff Lifeline mit 234 geretteten Menschen an Bord tagelang am Einlaufen in einen Hafen gehindert worden war. Ich wurde aktiv im bundesweiten Koordinierungskreis der Bewegung Seebrücke. Wir adressierten die Kommunen, denn sie nehmen die Menschen auf, und die Bundesregierung, die Bundesgesetze hätte ändern müssen, um die Aufnahme zu erleichtern. Ich habe begonnen, in Berlin dafür zu werben, und Gespräche mit Abgeordneten geführt. Dabei habe ich festgestellt, dass es im Bundestag überhaupt keine Idee gab, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Die, die von Integration redeten, waren noch nie in einer Unterkunft. Das war ungemein frustrierend. Deshalb entschied ich mich, für den Bundestag zu kandidieren.
Warum hast du die Bundestags-Kandidatur zurückgezogen?
Meine Kandidatur erreichte eine enorme Reichweite. Es gab viel Zuspruch, aber dann auch zunehmend Drohungen, Beleidigungen und rassistische Anfeindungen. Ich bekam teilweise hundert Morddrohungen am Tag. Da ich kein Amt hatte, gab es auch keinen Personenschutz. Ich wollte etwas verändern und damit Deutschland auch etwas zurückgeben. Dieses Land war aber nicht bereit für eine Kandidatur von Menschen wie mir.
Wurden die Syrer:innen deiner Meinung nach zu sehr als Hilfsempfänger betrachtet und ihre politische Geschichte nicht wirklich gesehen?
Ja. Mich hat genau das immer angetrieben. Ich habe aber heute durchaus Hoffnung, dass sich das verändern wird. Denn in den ersten Jahren waren die Syrer:innen damit beschäftigt, sich ihr Leben hier aufzubauen, die Sprache zu lernen, die Schikanen auszuhalten und, soweit möglich, ihre Familien nachzuholen. Aber viele Menschen sind durch und durch politisch. Sie haben eine Revolution angefangen und dahinter gibt es biografisch kein Zurück. Sie beginnen nach und nach, wieder aktiver zu werden. Das Erdbeben 2022 hat das noch verstärkt. Es gibt zahllose Exil-Initiativen, die sich politisch für Syrien engagieren.
Wie hat sich für dich der Fall des Regimes im letzten Jahr angefühlt? Und wie war es, nach der langen Zeit wieder nach Damaskus zu reisen?
Ich habe drei Tage nicht geschlafen, weil ich den Moment, in dem der Sturz bekanntgegeben wurde, nicht verpassen wollte! Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt. Das emotionalste Moment war für mich allerdings der Sturz der Assad-Statue in meinem Geburtsort. Das war am Tag vor dem Ende des Regimes. Die Statue stand dort schon, als ich geboren wurde. Schade nur, dass ich nicht dabei sein konnte. Kurz darauf bin ich allerdings nach Damaskus geflogen. Nach zehn Jahren wieder zurückzukehren und zu sehen, wie es der Familie geht, was die Menschen machen, wer noch lebt, das war unglaublich.
Am Tag nach dem Sturz des Regimes begann in Deutschland bereits eine Rückkehr- und Abschiebedebatte. Wie realistisch ist sie deiner Meinung nach?
Gemessen an dem, was ich früher und jetzt in Syrien erlebt habe, ist die Rückkehrdebatte realitätsfern – nicht nur wegen der aktuellen Lage in Syrien selbst, die humanitär und sozial immer noch verheerend ist. Aktuell würde auch kein deutsches Gericht Abschiebungen erlauben. Es zeigt sich erneut, dass der Populismus die Migrationsdebatte bestimmt. Viele Syrer:innen haben in den letzten Jahren versucht, hier anzukommen und auch tatsächlich dazuzugehören. Dass man am ersten Tag des neuen Syriens nur darüber spricht, ob und wie man sie schnell wieder loswerden kann, ist menschenverachtend.
Was sollte in Deutschland deiner Meinung nach jetzt passieren?
Anstatt sinnlose Rückkehrdebatten zu führen, hätte die Bundesregierung eine große Exil-Konferenz organisieren können. Aber es wird weiterhin nicht mit uns gesprochen, obwohl es in Deutschland die größte syrische Exil-Community Europas gibt. Sie sollte an den Verhandlungen auch mit der Übergangsregierung beteiligt werden. Sie repräsentiert sowohl einen bedeutenden Teil der deutschen wie der syrischen Bevölkerung.
Das Interview führte Mario Neumann.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 01/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!