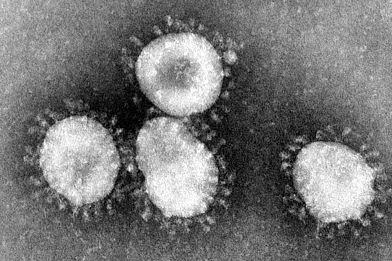Dies ist der erste Artikel einer Reihe von Texten zu verschiedenen Aspekten der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten.
Die Maßnahmen, die zur Eindämmung des Corona-Virus ergriffen worden sind, beunruhigen nicht nur deshalb, weil sie Einschränkungen von Grundrechten wie der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit beinhalten. Der Philosoph David Lauer sagte jüngst in einem Kommentar für den Deutschlandfunk: „Es ist nicht eine bestimmte zukünftige Entwicklung, die Angst erzeugt, sondern dass wir momentan überhaupt von jeder sinnvoll erwartbaren Zukunft abgeschnitten sind. Man könnte sagen: Was die Erfahrung der Corona-Krise kennzeichnet, ist nicht primär das Eingesperrtsein zu Hause, sondern mindestens so sehr das Eingesperrtsein in der Gegenwart.“
Unsere Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart sind wesentlich geprägt durch die Zukunft, die wir durch unser Handeln erst herbeiführen wollen, sagt er. „In diesem Sinne entspringt die Sinnhaftigkeit der Gegenwart eines Menschen seiner Zukunft.“
Die Gegenwartsfalle
Die beiden (räumlichen und zeitlichen) Facetten des von Lauer festgestellten existentiellen Bedeutungsverlusts, den viele Menschen in der derzeitigen Situation in Deutschland empfinden und der hierzulande als ein zeitlich begrenztes, notwendiges Übel erduldet wird, sind in den besetzten palästinensischen Gebieten – bei allen Unterschieden – seit Jahrzehnten ein Phänomen, das den Alltag und das Leben der Menschen wesentlich definiert, wenn auch nicht immer bewusst und im Vordergrund. Majeda Al-Saqqa von der Culture & Free Thought Association in Khan Younis (Gaza) formulierte ihr Dasein in der Gegenwartsfalle schon vor Jahren, als sie zugespitzt über ihren Alltag sagte: „Ich plane kaum länger als für ein paar Stunden oder Tage. In der Situation im Gazastreifen weißt du doch morgens nicht, was mittags sein wird.“
Um es konkreter zu machen: Wieso sollte sich ein junger Mensch in Gaza für einen guten Schulabschluss anstrengen, wenn sein Wunschfach dort an keiner Universität unterrichtet wird, sondern nur in Birzeit auf der Westbank? Er weiß, dass die israelische Civil & Liaison Administration (CLA) in Erez ihn sowieso nicht aus dem Küstenstreifen lassen wird. Wie planen Patient_innen ihr weiteres Leben, die für medizinische Behandlungen auf Zugang zu Krankenhäusern in Ost-Jerusalem, Ramallah, Nablus oder Israel angewiesen sind? Und was bedeutet es in einigen Fällen für ihre Chance zu überleben, wenn rund 40 Prozent aller Patient_innen aus Gaza ihre Termine versäumen, weil eben jene CLA ihre Anträge ablehnt, zu spät genehmigt oder nicht bearbeitet?
Je länger der Zustand des Abgeschnittenseins von der eigenen Zukunft fortbesteht, desto größere Verstörung kann er bewirken, sagt Philosoph David Lauer – mit Blick auf Deutschland in der Corona-Krise.
Die Erfahrung des lock-down ist Palästinenser_innen nicht fremd
Auch außerhalb von Gaza ist Palästinenser_innen die Erfahrung des lock-down nicht fremd. Temporäre Ausgangssperren für ganze Städte und Dörfer sind wiederkehrende Formen zur kollektiven Bestrafung und „Disziplinierung“ der Zivilbevölkerung. Viele erinnern sich auch noch an wochen-, in manchen Fällen monatelangen Ausgangssperren während der zweiten Intifada. Die israelische Armee ergreift solche Maßnahmen routinemäßig nicht nur gegen Ortschaften, aus denen (vermeintliche) Attentäter_innen stammen, sondern auch, wenn sich die Bevölkerung gegen die Armeepräsenz in ihren Dörfern auflehnt oder gegen die Übernahme von Feldern oder Quellen durch israelische Siedler_innen protestiert. Vor allen Dingen ist nicht zu vergessen, dass die Mehrheit der fast drei Millionen Palästinenser_innen die Westbank nicht verlassen darf, zumindest nicht in Richtung Israels, Ost-Jerusalems oder des Gazastreifens.
Gleichwohl ist das, was zurzeit geschieht, nur bedingt vergleichbar mit früheren Ereignissen. Seit Wochen riegeln Polizei und andere palästinensische Kräfte Bevölkerungszentren wie Ramallah, Nablus und Hebron ab im verzweifelten Versuch, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Es sind nicht mehr nur Fahrten zwischen den verschiedenen Gouvernements der Westbank untersagt, auch Bewegungen zwischen palästinensischen Städten werden unterbunden. Bethlehem, im Westjordanland die Stadt mit den meisten bestätigten Corona-Fällen, wurde schon früh durch die israelische Armee abgeriegelt. Palästinensische Kräfte tun das ihrige im Innern. Auch innerhalb der Städte sollen sie durchsetzen, dass die Bevölkerung ihre Mobilität auf das notwendige Mindestmaß reduziert: Arztbesuche und Gänge zum Supermarkt oder in die Apotheke.
Es überrascht leider nicht, dass dabei mitunter das Augenmaß verlorengeht. Seit Jahren fließt ein Drittel und mehr des Haushalts der palästinensischen Autonomiebehörde in den Unterhalt des Sicherheitsapparats und der Polizei, die nicht als Freund und Helfer glänzt, sondern vor allem zwei Aufgaben erfüllt: einerseits die Absicherung der Macht nach innen, sowohl gegen Proteste der eigenen Bevölkerung als auch gegen die politische Opposition, und andererseits die Sicherheitskoordination und -kooperation mit dem jeweiligen israelischen Gegenüber zugunsten der israelischen Sicherheit, wobei der Sicherheitsbegriff extrem weit gefasst ist.
medico-Partner helfen
Von Anfang an hatte die Autonomiebehörde die Hoheit in der Informationspolitik zum Coronavirus für sich beansprucht und angekündigt, alles, was sie als Falschmeldungen oder Panikmache betrachten würde, streng zu ahnden. Schließlich war es aber nicht die palästinensische Polizei im Westjordanland, die Freiwillige des medico-Partners Palestinian Medical Relief Society (PMRS) verhaftete, weil diese Informationsmaterial zum Corona-Virus verteilten. Die jungen Leute wurden im besetzten Ost-Jerusalem durch israelische Kräfte verhaftet, als sie im historischen Teil ihrer eigenen Stadt ihre palästinensischen Mitbürger_innen darüber informieren wollten, wie sie sich vor Ansteckung schützen könnten. Sie wurden nach kurzer Zeit unter der Auflage wieder frei gelassen, die Jerusalemer Altstadt für zwei Wochen nicht zu betreten. PMRS hat es trotzdem geschafft, in Ost-Jerusalem, Gaza und der Westbank mittlerweile 200.000 Broschüren zu verteilen und Poster zu plakatieren.
Die mobilen Kliniken der PMRS, die medico seit Jahren auch mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt, damit sie die Basisgesundheitsversorgung in abgelegenen oder von Siedler- bzw. Armeegewalt besonders betroffenen Ortschaften sicherstellen, sind weiter in Betrieb. Andere akute und chronische Erkrankungen nehmen in ihrem Verlauf auf Pandemien keine Rücksicht. Das mobile Klinikpersonal wurde deshalb mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet, um das Risiko für Personal und Patient_innen möglichst zu minimieren. Der Betrieb wird unter Berücksichtigung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhalten.
Überfordertes Gesundheitssystem
Das Vorgehen zur Eindämmung des Virus durch die palästinensischen Autoritäten, die weder in Gaza noch im Westjordanland im Ruf stehen, die Rechte der eigenen Bürger_innen besonders ernst zu nehmen, ist ein Drahtseilakt. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest die massive palästinensische Polizeipräsenz auf den Straßen zurückgenommen werden wird, wenn das Gröbste der Corona-Krise überstanden sein ist.
Gleichzeitig haben die Behörden keine Alternative zu den strengen Auflagen, denn es herrscht berechtigte Angst vor einem größeren Covid-19-Ausbruch, der mit Sicherheit den Kollaps des ohnehin fragilen und chronisch überforderten palästinensischen Gesundheitssystems verursachen würde. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren bis 5. April insgesamt 226 registrierte Fälle bekannt, davon 12 im Gazastreifen. Allerdings hat das örtliche Gesundheitssystem auch nur geringe Testkapazitäten und es gibt, wie in allen Systemen weltweit, eine Verzögerung bei der Erfassung neuer Fälle. Das öffentliche Gesundheitswesen im Gazastreifen verfügt laut WHO gerade einmal über 63 intensivmedizinische Plätze mit Beatmungskapazität, im Westjordanland sind es sogar nur 58. Rechnet man die Plätze in Privatkliniken hinzu, kommt Gaza mit seinen rund zwei Millionen Einwohner_innen auf insgesamt 87 Betten mit Beatmungsmöglichkeit, alle palästinensischen Einrichtungen auf der Westbank für ihre knapp drei Millionen arabischen Einwohner_innen auf 213 Plätze.
Es ist klar, dass die Kapazitäten schnell erschöpft wären, insbesondere wenn das Virus sich in dicht besiedelten Städten oder Flüchtlingslagern im Gazastreifen und Westjordanland ausbreiten würde. Die Lebensverhältnisse sowohl innerhalb der Familien als auch unter Nachbar_innen sind so beengt, dass nur schwer vorstellbar ist, wie unter derartigen Bedingungen Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung wie social distancing oder gar Quarantäne konsequent durchgeführt werden sollen.
Israelische Verantwortung
Neben medico international erinnern deshalb 18 israelische, palästinensische und internationale Gesundheits- und Menschenrechtsorganisationen die israelische Regierung an ihre Verpflichtungen gemäß Artikel 56 der IV. Genfer Konvention. Als Besatzungsmacht muss der israelische Staat gegenüber der palästinensischen Bevölkerung unter seiner effektiven Kontrolle, auch im Gazastreifen, aktive Schritte zur Sicherstellung des angemessenen Zugangs zu medizinischer Versorgung unternehmen. Unter den unterzeichnenden Organisationen befinden sich auch die langjährigen medico-Partner Adalah, das Al Mezan Menschenrechtszentrum in Gaza und Physicians for Human Rights – Israel. Wir fordern unter anderem die Aufhebung der Abriegelung des Gazastreifens, um angesichts der Corona-Pandemie ein angemessenes Funktionieren des Gesundheitssystems zu ermöglichen.
Neben der akuten Dringlichkeit dieser gemeinsamen Forderungen angesichts der Corona-Pandemie machen wir noch einmal darauf aufmerksam, dass auch für die Menschen im Gazastreifen und Westjordanland das Recht auf Freizügigkeit nicht davon abhängt, dass sie als Patient_innen dringend medizinischer Behandlung bedürfen. Sonst bleiben die Menschen in Gaza aus der Zeit gefallen – auch ohne Corona.