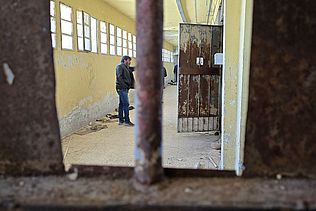Die geopolitischen Verschiebungen zwischen der Nachkriegszeit und dem Beginn des Kalten Krieges bilden die Geburtsstunde für die Hilfe aus dem Westen, so wie wir sie heute kennen. Die Gründung der Vereinten Nationen beinhaltete ein Versprechen einer verantwortlichen Welt- und Wertegemeinschaft, während Hilfsgelder den Westen als beste aller möglichen Welten erscheinen lassen, die Blockbildung beeinflussen und darüber hinaus Zugriff auf Rohstoffe sichern sollten. Mit dem Auseinanderbrechen der bisherigen Weltordnung steht nun auch die Hilfe – frei nach Elon Musks Motto „it's time for it to die“ – grundsätzlich zur Disposition. Die Siege rechter Kräfte weltweit haben die Welt noch schneller und radikaler verändert, als wir vielleicht gedacht haben und worauf wir vorbereitet gewesen wären - auch in der Praxis der Hilfe.
Das Schmelzen des liberalen Zuckermantels
Nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Donald Trump wurde die amerikanische Behörde für Entwicklungszusammenarbeit de facto abgeschafft. Inzwischen sind 83 Prozent der Projekte eingestellt. Von der amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation, dem größten Geldgeber weltweit, ist fast nichts mehr übrig. Schon jetzt sieht man die verheerenden Folgen der Entscheidung: In den durch USAID finanzierten Flüchtlingslagern konnte die Versorgungsinfrastruktur von einer Woche auf die nächste nicht mehr aufrechterhalten werden. Brot und Wasser fehlen für Hunderttausende. Impfprogramme geraten ins Stocken und Schulen müssen schließen. Besonders gefährlich ist es bei epi- und pandemischen Krankheiten wie AIDS oder Polio. Tausende werden weltweit völlig unnötig an den Folgen dieser fehlenden Medikamente sterben.
Eine Entwicklung, die schockiert doch keinesfalls US-spezifisch ist. Dem erratischen Trump steht kein vernünftiges und verantwortungsbewusstes Europa gegenüber. Als Vorläufer gilt Großbritannien, das schon 2020 unter dem rechten Premierminister Boris Johnson nach lautem Aufschrei das Entwicklungsministerium mit dem Auswärtigen Ministerium fusionierte. Bis heute können die Folgen nicht aufgefangen werden. Die Unterstützung für Länder wie Pakistan und Südsudan wurde beispielsweise um mehr als die Hälfte gekürzt und Mittel für humanitäre Krisen und Klimaschutzprogramme erheblich eingeschränkt. In Ländern wie Sierra Leone, die wesentlich auf britische Beiträge angewiesen waren, hat dies die Verfügbarkeit von Grundversorgungsmitteln wie Trinkwasser, Nahrung und Medikamenten massiv beeinträchtigt.
Großbritannien ist damit in Europa kein Einzelfall. Vielleicht nicht ganz zufällig sind es die alten Kolonialmächte, bei denen sich eine ganz ähnliche Tendenz abzeichnet. Die Niederlande haben 30 Prozent ihres Entwicklungshilfebudgets gekürzt und die Mittel auf Projekte umgeschichtet, die „direkt den niederländischen Interessen dienen“. Belgien kürzte seine Hilfe um 25 Prozent, während Frankreich sein Budget um mehr als ein Drittel reduzierte. Weitergedreht wurde das Rad indes im Vereinigte Königreich, wo die Auslandshilfe um erneute 40 Prozent gekürzt und im selben Atemzug die Verteidigungsausgaben erhöht wurden. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Entscheidung als „äußerst schwierig und schmerzhaft“, da in ganz Europa die Besorgnis über das schwankende Engagement der USA für die europäische Sicherheit wachse.
Auch Deutschland plant nun eine drastische Kürzung des Etats für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäres, bei gleichzeitiger Aufstockung des Wehretats. Schon im letzten Haushaltsentwurf der Ampel-Regierung war eine Halbierung der Mittel für die humanitäre Hilfe vorgesehen. Von der durch Deutschland mitgetragenen Vereinbarung der Vereinten Nationen, wonach jedes Land 0,7 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für die humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen soll, ist nichts geblieben. Eine Tendenz, die sich mit der neuen Bundesregierung unter Friedrich Merz verschlimmern wird.
Dass das deutsche Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht dasselbe Schicksal erleben würde wie das Britische Ministerium, wurde erst letzte Woche klar. Nach aktuellem Koalitionsvertrag darf das Ministerium nun doch bleiben. Es wird aber klar gemacht, dass es fortan um Sicherheitspolitik gehen müsse. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu treffend: „Wir brauchen grundlegende Veränderungen in der Entwicklungspolitik, die aktuelle geopolitische und ökonomische Realitäten stärker abbilden und gestalten müssen. (…) Im Lichte unserer Interessen werden wir stärker auf folgende strategische Schwerpunkte setzen: wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen, Fluchtursachenbekämpfung sowie die Zusammenarbeit im Energiesektor“.
Werte, sind schön und gut, aber nicht in der Zeitenwende. Gleichheit, Demokratie, Frieden, Gemeinschaftlichkeit und rechtebasiertes Handeln auch im internationalen Kontext – alles einst Teil eines gemeinsamen Werterahmens – haben nun ausgesorgt.
Ist es schockierend? Nein.
Der Rahmen internationaler Beziehungen war bereits zuvor mehr als brüchig. Sichtbar wird das wohl in der Hochphase der „Werte geleiteten“ Politik. Damals mussten Kriege mit der Verteidigung liberaler Werte begründet werden: Die USA bringt die Demokratie in den Irak und befreit noch dabei die irakischen Frauen vom Patriarchat. In diesem Zuge wurde der Begriff „embedded Feminism“ eingebetteter Feminismus eingeführt, also dass eine liberale Form des Feminismus in zerstörerischem Agieren des Staates eingebettet wird, um dieses zu legitimieren. Im Windschatten der Irak-Intervention wurde der öffentliche Dienst zudem brutal gesäubert und über die Zerschlagung von sozialer Infrastruktur eine neoliberale Transformation des Irak vollzogen. Auch die Hilfe spielte damals eine Rolle. medico sprach damals von „embedded Aid“ also eingebetteter Hilfe. Es bedeutete, dass die Hilfe fast ausschließlich in Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen, damals der USA im Irak, dann später Deutschlands in Afghanistan, eingebettet und sich den jeweiligen Sicherheitsstrategien unterordnen musste. Humanitäre Hilfe konnte damals nur in Absprache mit den kriegführenden Armeen durchgeführt werden und wurde damit zu einem politischen Instrument im Krieg. Was wir jetzt erleben ist also nicht grundsätzlich neu, erlangt aber durch seine Zuspitzung eine neue Qualität.
Die große Veränderung besteht im Wegfall des Rechtfertigungsdrucks. Vorhandene aber ungesagte Interessenpolitiken stehen nicht mehr unter dem Druck - durch Hilfe – kaschiert oder gerechtfertigt zu werden, sondern werden offensiv und lauthals ausgesprochen. Das nationale und chauvinistische Staatsinteresse erscheint legitim und bedarf keines Deckmantels mehr. Die Verabschiedung von der Idee einer solidarischen Weltgemeinschaft vollzieht sich ohne Scham.
Der liberale Zuckermantel schmilzt unter der heißen Sonne des Rechtsrucks und der Zeitenwende. Die Menschen der „Mehrheitswelt“ beziehungsweise des globalen Südens, die in dessen Namen doch geschützt und ob der Großzügigkeit ihrer Ausbeuter, Hilfe bekommen durften, hielten in der Regel herzlich wenig davon. Wie es Nicholas Mwangi, Ko-Herausgeber des Buches „Breaking the Silence on NGOs in Africa“ aus Kenia bei unserem letzten Besuch formulierte: „Sie nehmen mir neun Finger und geben nur den kleinen Finger zurück und schmücken sich noch damit.“

Vom Irak über Afghanistan nach Gaza: Hilfe kritisieren und verteidigen
Der Leitsatz „Hilfe kritisieren, verteidigen und überwinden“ ist lange wegweisend für die Arbeit von medico. Doch wie kann die fortlaufend wichtige Kritik der Hilfe fortgesetzt werden, wenn deren Grundsätze so substantiell in Frage gestellt sind? Staatsinteressen-geleitete Hilfe zu kritisieren stand nicht im Widerspruch dazu, auch mit Staatsgeldern eine Form der Umverteilung zugunsten der Zivilgesellschaften im globalen Süden vorzunehmen, die sich ebenso genau diesen Zurichtungen widersetzen. Auch wenn keine Zivilgesellschaft vollkommen unabhängig ist, verkleinert die Kürzung der Mittel deutscher Entwicklungszusammenarbeit auch für medico den Spielraum sich in den Ambivalenzen der Hilfe zu bewegen. Obwohl Hilfe auch immer ein Machtverhältnis ist, das man sich bewusst machen muss, ist gleichzeitig für eine im Norden agierende Menschenrechtsorganisation das Recht auf Hilfe einer der möglichen Zugänge zur Solidarität.
medico verteidigt die Hilfe deshalb vor allem da, wo sie als Menschenrecht verweigert wird, zum Beispiel in Gaza. Denn die Hilfe zu überwinden, heißt nicht in Zeiten der Not die Hilfe und das Gegenseitige ehrliche Beistehen, abzuschaffen. Hilfe überwinden heißt, die Gründe der Not gemeinsam zu überwinden und nicht nur die Not lindern. Die Missstände zu überwinden, ist eine politische Frage der Gerechtigkeit. Für globale Gerechtigkeit braucht man allerdings Solidarität, das gemeinsame und gegenseitige sich Wiederkennen im Ringen um eine emanzipierte und selbstbestimmte Form des Lebens, die nach Kontext und Ort ganz anders aussehen kann.
Hilfe überwinden: das Recht auf Leben
Die verschiedenen aktuellen Angriffe auf die Hilfe, die Zivilgesellschaft, die Bewegungen, sind in ihrem Kern alle ein Angriff auf die Idee, dass Menschen unterschiedslos ein Recht auf Existenz, Leben, Würde und Selbstbestimmung haben. Die politische Praxis von medico und unseren Partner:innen besteht deswegen gerade in Zeiten des Rechtsruck darin, sich der Logik der De-Humanisierung entgegen zu stellen. Denn trotz all ihrer Ambivalenzen, eröffnet die Hilfe eine politische Arena für zivilgesellschaftliche und andere politische Akteure im internationalen Raum, der ansonsten nur Staaten und multilateralen Organisationen vorbehalten wäre. Wie die Sprecherin für globale Gerechtigkeit der Linkspartei, Cornelia Möhring, und Afrikareferent der Rosa Luxemburg Stiftung Andreas Bohne in einem Artikel zu den Kürzungen der Entwicklungsgelder erklären, ist das Hilfesystem auch eine Projektionsfläche, auf der globale Solidarität immer wieder neu formuliert und verteidigt werden kann. Dort kann eine macht- und kapitalismuskritische Perspektive von unten formuliert werden. Es entstehen Netzwerke, die zwischen (transnationalen) sozialen und politischen Bewegungen und der staats- und multilateralen Ebene navigieren können. Netzwerke, die gleichzeitig lokal verankert sind, wie zum Beispiel das People´s Health Movement oder die Via Campesina. Es sind diese politische Arena und die Hebel, die es zu verteidigen gilt, nicht die Hilfe in ihrer gegenwärtigen Form.
Diese globalen Verknüpfungen finden auch in den beharrlichen Bewegungen der Migration Ausdruck. Migration fordert den Rückzug ins Nationale und die reaktionären Abschottungsphantasien immer weiter heraus. Migrationsbewegungen sind eine Realität, die mehr als Sand im Getriebe eines aufziehenden Autoritarismus bilden. Der Kampf um Bewegungsfreiheit, den wir gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen führen, ist ein Kampf um das Recht auf Leben und gleichermaßen ein Kampf für Demokratisierung und gegen wachsenden Nationalismus.
Gerade auch im Bereich der Gesundheit, die wir nicht nur als die Abwesenheit von Krankheit verstehen, sondern als die Möglichkeit ein gutes Leben führen zu können, dass nicht krank macht, lässt sich das Prinzip der Hilfe als solidarische Praxis ausbuchstabieren. Anstatt der Welle der Nationalisierung und Patentierung mitzugehen, die durch die Corona-Pandemie massiv verschärft wurde und vor allem Konzerninteressen schützt, haben wir uns mit unseren Partner:innen der Idee von Gesundheitsgütern als Commons - Gemeinschaftsgütern – verschrieben und stellen uns gegen die Patentierung der Impfstoffe. Nur so lassen sich die Krisen der Gegenwart und der Zukunft bearbeiten oder sogar verhindern.
Schon lange tun wir dies mit unseren Partner:innen, die sich gegen die Privatisierung des Gesundheitssektors stellen und Gesundheitsstrukturen aufgebaut haben, die Versorgung für alle ermöglicht. In Bangladesch setzt sich beispielsweise Gonoshasthaya Kendra (GK) für eine selbstorganisierte Gesundheitsversorgung ein. Mit über 2.500 Mitarbeitenden organisieren sie seit Jahrzehnten Basisgesundheitsdienste für über eine Million Menschen – oftmals den Ärmsten unter den Armen in Slums, Textilfabriken und ländlichen Gegenden. Gleichzeitig ist GK Teil des globalen People's Health Movement und kämpft dort gegen die Ursachen krankmachender Verhältnisse. In Zeiten internationaler Kürzungen zeigt ihr Beispiel: Hilfe muss in die eigenen Hände genommen werden und wir können dabei solidarisch unterstützen.
Solidarität ist ein Prozess
Die Hilfe zu kritisieren, zu verteidigen und zu überwinden ist ein Teil solch solidarischer Praxis und ein Teil davon Zukunftsvisionen zu weben. Wir kritisieren Hilfe da, wo sie als Wolf im Schafspelz Menschen ihrer Würde, Selbstbestimmung oder Eigenständigkeit beraubt und private oder staatliche Interessen verfolgt. Es gilt weiterhin und nun im globalen Rechtsruck unter erschwerten Bedingungen, die Ursachen der Not, die Hilfe erst nötig macht, zu überwinden. Wir verteidigen die Praxis der gegenseitigen Hilfe als solidarische Praxis und als Menschenrecht, gerade wenn sie Menschen verwehrt wird, und sehen sie als ein Zugang zu Solidarität aber nicht als Endziel.
Solidarität ist keine Einbahnstraße von Nord nach Süd. Solidarisch sein, heißt gemeinsam und unter den verschiedenen Bedingungen der Differenzen zwischen den Beteiligten Räume zu schaffen, um die Welt zu gestalten. Während unsere Partner:innen die politischen Räume in ihren Kontexten und auf transnationaler Ebene verteidigen und offen halten, kommt uns dabei die Aufgabe zu, dies auch in Deutschland und auf transnationaler Ebene zu tun. Räume, in denen Visionen geschmiedet und Forderungen formuliert werden können, denn rechte Angriffe auf sie wirken nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft. Auf eine Zukunftsvision, in der eine gemeinsame Welt von den Rändern und aus der Basis heraus gedacht werden kann.
Helfen Sie mit, das Recht auf Hilfe zu verteidigen – gegen die Gleichgültigkeit und die Logik der Nützlichkeit. Unterstützen Sie unsere Partner:innen weltweit mit Ihrer Spende. Für eine solidarische Praxis von unten, die sich nicht beugt und eine unabhängige und kritische Hilfe gewährleistet.